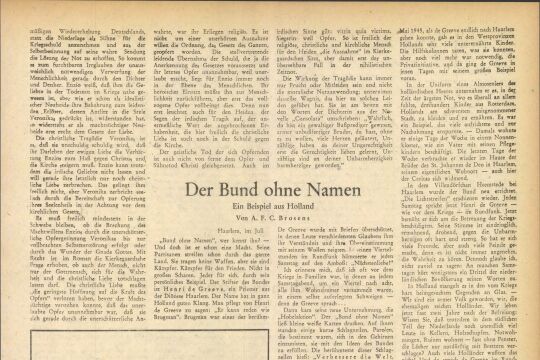Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Was ist Natur?
Kann das gut gehen, wenn neun Universitätsprofessoren — noch dazu aus verschiedensten Disziplinen - sich zu einem Streitgespräch um einen Tisch versammeln? Wird da nicht pausenlos in Monologen aneinandervorbeige-redet? Das Forum „St. Stephan” in Wien unternahm am 26. Jänner diesen etwas gewagten Versuch — und herauskam eine recht interessante Veranstaltung.
„Natur zwischen Steuerung und Selbstregulierung” war ihr Titel. Aber schon aus der Einladung war zu entnehmen, daß es um den Menschen gehen würde. Die Vielfalt der Aussagen läßt sich — auch in Stenogrammform — nicht wiedergeben, aber wesentliche Gesichtspunkte seien hier angemerkt.
Da war zunächst die Klarstellung, daß wir zwar alle von Natur sprechen, damit aber sehr Unterschiedliches verbinden: Gott habe alles geschaffen — in endgültiger Form, dachte etwa das Mittelalter. Man wußte zwar von der Abfolge von Werden und Vergehen. Im Grunde aber blieb alles gleich.
Anders die evolutionistische Sicht: Man hatte entdeckt, daß die Arten.je später sie auftraten, umso komplexer strukturiert waren. Auch hatte man innerhalb der Arten einen Wandel der Erscheinungsformen erkannt. Die Folge: Natur wurde als Einheit angesehen, die sich zielgerichtet höher entwickelt. Der Mensch erscheint darin als bisher höchste Entwicklungsstufe.
Ist der Mensch also Natur? Je nachdem, wie man die Dinge betrachtet, antwortet darauf die systemtheoretische Naturbetrachtung. Betrachtet man die Erde als ein großes Ganzes miteinander in Beziehung stehender Einheiten, so ist der Mensch selbstverständlich Teil der Natur.
Diese Art, Natur zu betrachten, sei wohl heute angemessen, meinte der Wiener Physiker Gernot Eder, der einleitend auf die unterschiedlichen Naturbegriffe hingewiesen hatte.
Aus seiner Sicht jedoch, meinte der Wiener Soziologe Erich Bodzenta, sei es vor allem bedeutsam, daß der Mensch Kultur schaffe. Seine biologischen Bezüge seien im Vergleich dazu unbedeutend.
Einigen konnte man sich weder auf Begriffe, noch auf Abgrenzungen. Die Frage blieb im Raum stehen, wie viele andere auch an diesem Tag. Sie regten aber zum Nachdenken an.
Nachdenklich stimmten auch die selbstkritischen Äußerungen des Grazer Ökonomen Stefan Schleicher. „Wir haben eine etablierte Spielwiese”, kennzeichnete er die Situation in seinem Fach. Innerhalb des bisher allgemein anerkannten Denkrahmens habe man eine ausgefeilte Rationalität entwickelt, genaue Vorstellungen, wie man an die Dinge heranzugehen habe.
Da lasse sich vieles prächtig ausrechnen. Schade allerdings, daß trotz allem die Ökonomen recht wenig zu den wesentlichen Fragen unserer Zeit beizutragen haben - oder bestenfalls im nachhinein. Schleicher sprach von einem „nacheilenden inhaltlichen Opportunismus, weil zu den dominanten gesellschaftlichen Konflikten — wie Krieg und Frieden, Hunger und Uberfluß, Ressourcen-erschöpfung und Umweltzerstörung — die Beiträge der Ökonomen erst spät und interessenbezogen vernehmbar wurden.”
Die wirtschaftlichen Modellvorstellungen seien einfach nicht angemessen. Sie erweckten den falschen Eindruck, man könne alles unabhängig von Zeit und Raum beliebig nach Gesetzmäßigkeiten steuern.
Diese Selbstkritik stieß bei manchen Naturwissenschaftlern auf Erstaunen. Mit den eigenen Modellen habe man keine Probleme.* Im Gegenteil: Die Genforschung stehe vor ungeahnten neuen Möglichkeiten.
Ob nicht gerade der Naturwissenschaft eine ähnliche Nachdenklichkeit gut täte? Schließlich haben ja ihre Einsichten bedeutsame Folgen für den Menschen. Zweifellos dauert die Umsetzung ihrer Forschungen länger. Die von den Ökonomen beeinflußte Wirtschaftspolitik hat da unmittelbarere Folgen auf unser Leben.
Die Naturwissenschaften sind vergleichsweise fernab vom Schuß. Sie können sich leichter der Illusion hingeben, man könne wertfrei Informationen sammeln-und Modelle bauen.
Weil aber weltweit mit dem Ziel geforscht wird, dem Menschen Mittel in die Hand zu geben, um verändernd in seine Umwelt eingreifen zu können, wird auch der Naturwissenschaftler vor Wertfragen gestellt: Sind seine zunehmend undurchschaubaren Modelle dem Menschen zuträglich?
Denn beliebig veränderbar sei der Mensch nicht, stellte der Wiener Theologe Raphael Schulte fest. Man könne zeitlos Gültiges über den Menschen sagen, dem müsse man Rechnung tragen: Der Mensch erlebe sich als „Ich im Wir”, erfahre sein Leben als etwas Einmaliges, sei seit jeher religiös ansprechbar und zwar darauf, daß eine jenseitige Existenz an ihm interessiert sei.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!