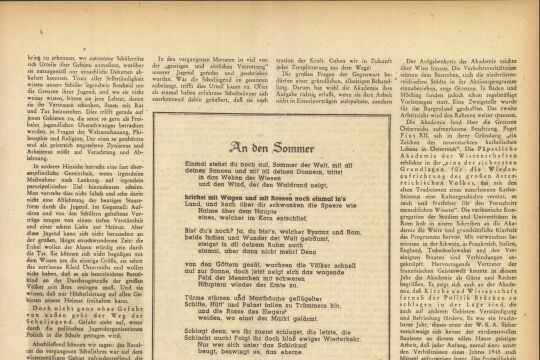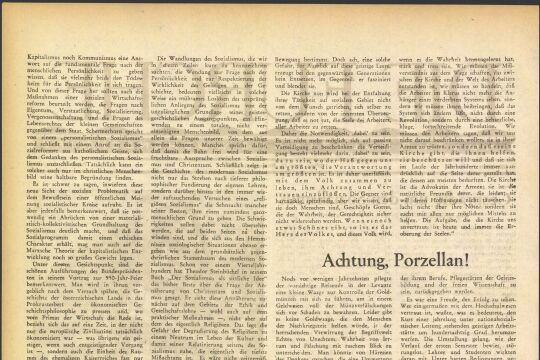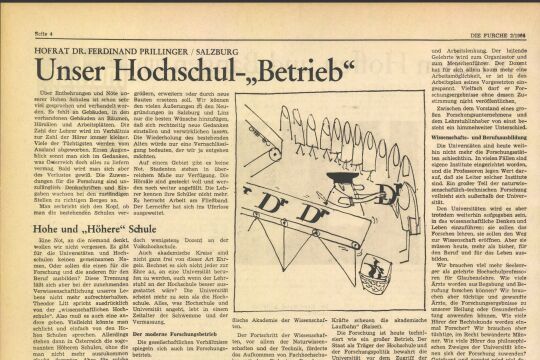Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Was weiß man von der Universität?
Was weiß der „Mann auf der Straße“ von Österreichs Universitäten? Was verbindet er mit Begriffen wie „Forschung“, „Professor“ , „Toxikologie“, „Hochschulstudiengesetz“? Befrager des Fessel-Instituts werden in den kommenden Wochen umgehen, um festzustellen, wie sich das Bild der Universität im Kopf des Herrn und der Frau Österreicher darstellt. Denn diese sind es, die mit ihren Steuerleistungen die Arbeit der Universitäten überhaupt erst möglich machen.
Es ist, auch international gesehen, das erste Mal, daß die Hochschulen eines Landes zu einem bestimmten Termin und mit gezielten Veranstaltungen gemeinsam vor die Öffentlichkeit treten, um Rechenschaft abzulegen über ihre Leistungen und um Verständnis zu erbitten für ihre Anliegen. Vom 25. bis 31. März läuft in zwölf wissenschaftlichen und sechs Kunsthochschulen Österreichs die „Informationswoche“. Hier sollen besser als bei den üblichen „Tagen der offenen Tür“ vor allem auf dem Weg über Massenmedien und öffentliche Veranstaltungen auch jene Menschen angesprochen werden, die noch keinen direkten Bezug zur Universität oder zur Kunsthochschule besitzen.
Zu sehr assoziiert der Bürger mit dem Begriff „Universität“ noch Studentenunruhen, verschmierte Wände, Männer in weißen Mänteln, die unverständlich sprechen. Was weiß er schon davon, daß und wie auf den Universitäten nicht nur Lehrer, Beamte, Arzte, Priester ausgebildet werden, mit denen er selbst immer wieder zu tun hat; daß auf den Universitäten die Voraussetzungen geschaffen werden für die Weiterentwicklung der Wirtschaft, für die Verbesserung des Gesundheitswesens,
für immer neue Erleichterungen unseres Lebens. Und schon gar nicht ist ihm bewußt, daß die Universität heute ein Großbetrieb mit Zehntausenden von Arbeitsplätzen ist, geführt wie ein Industriebetrieb vergleichbarer Größe.
Die Zeiten sind längst vorbei, wo sich der Gelehrte in sein Kämmerlein einschließen konnte, um sich seinen Forschungen hinzugeben und deren Ergebnisse dann einem kleinen Kreis treuer Schüler mitzuteilen. Die Universität ist zur Massenausbildungsanstalt geworden - die Zahl der Studenten hat sich in den letzten zwanzig Jahren verfünffacht. Die Universität hat aber auch ihre Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und dem Staat konkreter erkannt, ihre Vertreter sind längst diskussionslos gewillt, dieser Verantwortung gerecht zu werden.
Damit hat sich aber auch die Haltung der Universität und ihrer Repräsentanten gegenüber der Öffentlichkeit grundlegend gewandelt. Vor 20 Jahren konnte der Journalist, der von einem Wissenschaftler Auskunft über seine Forschungsarbeiten haben wollte, oft genug die Antwort erhalten, das gehe niemanden etwas an, das verstehe ohnehin niemand. Das gibt es heute nicht mehr. Wie sich der Rektor in diesen zwei Jahrzehnten von der reinen Repräsentationsfigur zum Spitzenmanager mit stark politischen Aufgaben gewandelt hat, so ist auch der Forscher selbst in den meisten Fällen vom Einzelgänger zum Mitglied einer Gemeinschaft geworden, durchaus bereit, seine Erkennt-niß auch einem weiteren Kreis mitzuteilen.
An dieser Wandlung hat nicht nur die Entwicklung der Gesellschaft im allgemeinen mitgewirkt, deren Demokratisierungsprozeß auch die
Hochschulen eingeschlossen hat. Am Verhältnis zwischen der Wissenschaft und der Öffentlichkeit hat die Entstehung eines eigenen Wissenschaftsjournalismus - in Österreich nicht zuletzt dank der Existenz und Tätigkeit des „Informationsdienstes für Bildungspolitik und Forschung“ - wesentlichen Anteil. Die Teilnahme journalistischer Berichterstatter in den Sitzungen der Rektorenkonferenz wie einst in der Hochschulreformkommission, die Aufarbeitung ihrer Ergebnisse für das Verständnis des Medienkonsumenten haben entscheidend zur Entzerrung verkrampfter Haltungen auf beiden Seiten mitgeholfen.
Hierzu soll auch die Informationswoche im März beitragen. In Wien mit seinen fünf Universitäten und drei Kunsthochschulen mußte eine
gemeinsame Auswahl getroffen werden. Die Universitäten der Bundesländer programmieren in Eigenregie.
Diese erste Informationswoche soll ein Versuch sein, neue Wege zu gehen. Niemand wagt vorherzusagen, wie der Erfolg sein wird. Die Grundidee aber ist richtig - wir alle brauchen die Wissenschaft, die für die Gestaltung unseres immer komplizierter werdenden Lebens unentbehrlich geworden ist. Aber gerade diese Kompliziertheit ist geeignet, das vorhandene Mißtrauen noch zu verstärken. Auch zwischen dem Wissenschaftler und dem „Wissenschaftskonsumenten“ - das sind wir alle -muß Vertrauen herrschen. Und dazu ist ein besseres Wissen von einander Voraussetzung.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!