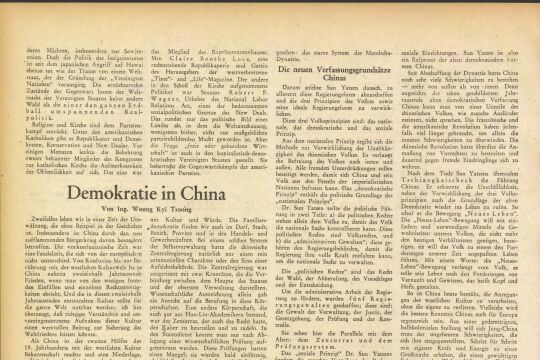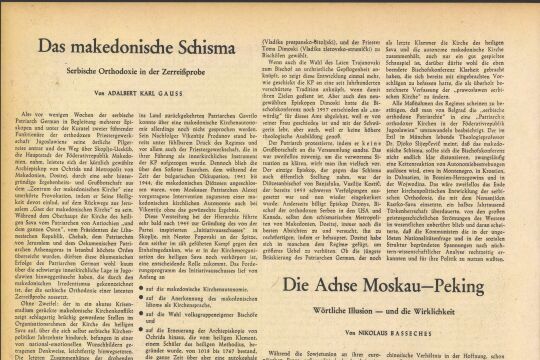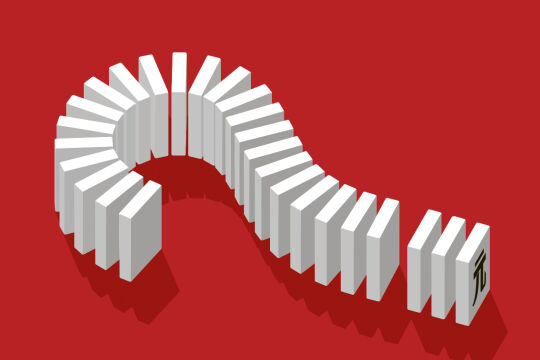Was Wirtschaftsdelegationen in China schlimmstenfalls bewirken können
Vom 30. März bis 7. April reist eine hochrangige Wirtschaftsdelegation mit Bundeskanzler Franz Vranitzky an der Spitze nach Hongkong und China. Zweck des Trips in den Fernen Osten sind „politische und wirtschaftliche" Gespräche. Welchen Sinn kann diese Reise haben?
Vom 30. März bis 7. April reist eine hochrangige Wirtschaftsdelegation mit Bundeskanzler Franz Vranitzky an der Spitze nach Hongkong und China. Zweck des Trips in den Fernen Osten sind „politische und wirtschaftliche" Gespräche. Welchen Sinn kann diese Reise haben?
Chinas kommunistische Führung hat aus den Ereignissen von 1989 gelernt. Sie kann sich nur an der Macht halten, wenn sie ein wenig Prosperität zustandebringt; wenn sie ihrem inzwischen auf 1,2 Milliarden Menschen angewachsenen Volk einen halbwegs zufriedenstellenden Wohlstand gönnt. Dazu braucht sie die Marktwirtschaft - oder zumindest Elemente davon. Also: Ja zu individueller Leistung, Eigeninitiative und Privatsphäre. Das wurde Anfang dieser Woche auch bei der Jahrestagung des 8. Nationalen Volkskongresses der Volksrepublik China bekräftigt.
Aber die Machthaber in Peking haben noch etwas auf das Panier geschrieben: Eine Demonstration mit Forderungen nach mehr politischer Freiheit wie 1989 auf dem „Platz des Himmlischen Friedens" darf es nicht mehr geben. Der absolute Führungsanspruch der Kommunistischen Partei muß unangefochten bleiben. Also: Nein zu politischer Freiheit und demokratischer Willensbildung. Auch das machte die Pekinger Führung dieser Tage unmißverständlich dem In- und Ausland klar.
Daran wird sich auch nichts ändern, meinte kürzlich der deutsche China-Spezialist Per Fischer, selbst wenn jetzt die chinesische Führung den einen oder anderen politischen Gefangenen freiläßt. Nach wie vor, so der Ex-Botschafter und Professor für Politikwissenschaft in Mainz, herrsche Willkür mit Verhaftung, Verurteilung oder Einweisung ohne Gerichtsbeschluß in eines der berüchtigten 3.000 Arbeitslager.
Chinas Opposition - falls es sie überhaupt noch gibt - hat sich jedenfalls von den brutalen Ereignissen 1989 auf dem Tiananmenplatz, den darauffolgenden Verhaftungen, Folterungen und Verbannungen noch nicht erholt. Erholt von den schok-kierenden Bildern des Massakers hat sich aber der Rest der Welt. Den Machthabern in Peking wurde ohnehin nicht lange wegen ihren Menschenrechtsverletzungen die kalte Schulter gezeigt. Bald kam die Wirtschaft wieder. Dann folgte die Politik.
Auch Österreich ist da keine Ausnahme. „Made in Austria" ist in China schon ein Begriff. Joint Ventures, Projektgeschäfte, Repräsentanzbüros in rotweiß-rot sind längst vertreten. Wie schon Heinz Fischer und Franz Löschnak vor ihm, reist jetzt auch Kanzler Franz Vranitzky Ende März zu - wie es heißt -„politischen und wirtschaftlichen Gesprächen" nach Hongkong und China. Mit im Troß auch Manager, Unternehmer und hochrangige Kammerfunktionäre.
Österreich will in China die Gunst der Stunde nützen: Das „Reich der Mitte" mit 1,2 Milliarden Menschen ist offen für Investoren, westliches Know-how und florierende Handelsbeziehungen, um den Aufbau der großteils rückständigen Wirtschaft voranzutreiben. Chinas Ministerprä-
sident Li Peng sorgte für einen entsprechenden wirtschaftlichen Reformschwung, der jetzt massiv fortgesetzt wird. Die im letzten Fünf-Jahres-Plan (1991 bis 1995) fixierte Wachstumsrate von vollen sechs Prozent mußte sogar nach oben revidiert werden, während bei uns die Korrekturen nach unten einander jagen.
Eben weil unsere Wirtschaft lahmt, müssen Exporteure sich nach neuen Handelsmöglichkeiten umsehen. Der traditionelle Partner Deutschland wird vermutlich noch tiefer in die Krise geraten, die. auf Ausfuhr angewiesene Wirtschaft wird das noch deutlicher zu spüren bekommen. Daß man jetzt versucht, über die bisherigen Grenzen hinaus zu denken und neue Märkte zu erobern, liegt übrigens im Trend. In Deutschland beispielsweise wird sogar schon bayerischen Handwerkern nahegelegt, auch außerhalb Europas Fuß zu fassen.
Im letzten Herbst sahen sich österreichische Unternehmer unter der Führung von Wirtschaftsminister Wolfgang Schüssel auch schon auf einem anderen Hoffnungsmarkt im Fernen Osten um: in Indien (siehe FURCHE 5/1993). Jetzt wird China ins Visier genommen. Besser dort einsteigen also sonstwo oder gar nirgends, scheint die Devise zu sein. Und hat nicht sogar der amerikanische Trendforscher John Naisbitt („Megatrends 2000") kürzlich in Wien mit Nestorstimme Journalisten und Managern prophezeit: Die Marktwirtschaft wird ihren Siegeszug fortsetzen. Und nicht nur das. In China werden bis zur Jahrtausendwende - also in nicht einmal sieben Jahren! - sogar freie Wahlen und ein Mehrparteiensystem möglich sein. Wenn das schon ein berühmter amerikanischer Guru sagt - soll man da nicht wirklich Mut fassen?
Tatsächlich entwickelt sich Chinas Wirtschaft aber zwiespältig. Betroffen vom be neidenswerten Wachstum sind haupt sächlich die Provinzen, Städte und Handelszentren an der Küste. Die Industrie präsentiert sich in einem maroden Zustand, umweltverpestend und hoffnungslos veraltet. Die staatlich gegängelte Landwirtschaft erweist sich ebenfalls als reformbedürftig (800 Millionen Chinesen arbeiten immer noch auf dem Land). Der Anteil Chinas am Welthandel beschränkt sich auf mickrige 1,8 Prozent. (Was allerdings nicht verwunderlich ist. Länder dieser Größenordnung - und erst recht planwirtschaftlich organisierte - sind nicht so stark auf Außenbeziehungen angewiesen wie beispielsweise das kleine Österreich.)
Mehr Wohlstand, aber keine politischen Rechte. Das ist derzeit die Parole. Die Partei hat in China also das Heft weiterhin fest in der Hand. Das ist natürlich - zumindest in westlichen Augen - ein waghalsiges Experiment. Die liberalen Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler sind davon überzeugt, daß wirtschaftliche und politische Freiheit zusammengehören. Das heißt, daß man auf Dauer Marktwirtschaft und Einpartei-Diktatur nicht verknüpfen kann. Das Schicksal der „Perestrojka" ist für die Anhänger dieser Lehre ein Beweis ihrer These. Michail Gorbatschow mußte in ihren Augen scheitern, weil er mit Hilfe der Marktkräfte modernisieren, aber die kommunistische Parteiherrschaft weiterbestehen lassen wollte. Feuer und Wasser lassen sich eben nicht mischen, sagen die Verfechter der „Interdependenz der Ordnungen".
In China scheint man das aber zu glauben. Die Frage ist nur, kann das chinesische Modell einer „sozialistischen Marktwirtschaft" überhaupt funktionieren? Und wenn ja, wie lange? Denkbar wäre natürlich, daß solche liberalen Theorien nur für europäische Gesellschaften - mit westlichem Verständnis von Wirtschaft und Politik und liberalem Kulturhintergrund -gelten.
Aber China ist bekanntlich anders. Daher kann auch heute niemand seine Hand dafür ins Feuer legen, daß unter spezifisch chinesischen Bedingungen die Dinge nicht doch anders laufen können. Es ist schwierig, hier Voraussagen zu machen. Welche Gründe haben die chinesischen Führer, entgegen allen bisherigen historischen Erfahrungen darauf zu vertrauen, daß man eine Marktwirtschaft einführen und dabei das repressive politische System aufrechterhalten kann? Denken sie insgeheim selbst schon an einen politischen Systemwandel? Für die Beantwortung dieser Frage gibt es bereits Denkanstöße:
China nimmt ganz bewußt Umwege auf dem Weg zum Sozialismus in Kauf. Sie werden sogar eingeplant, analysiert Rüdiger Machetzki vom Hamburger Institut für Asienkunde. Komplette Angleichungen an den Kapitalismus sind nach Pekinger Überzeugung eine ideologische Ver-irrung, die verhindert werden muß. Das Problem für die Führung ist nur, wie kann die Eigendynamik des kapitalistischen Prozesses unter Kontrolle gehalten und beherrscht werden? Dazu muß, so meint Machetzki, politisch bewußt gegengesteuert werden. Das heißt, mehr Druck und Repression von oben.
Das scheint schlüssig zu sein: China läßt sich derzeit auch nicht von außen zur Einhaltung der Menschenrechte zwingen. KP-Chef Jiang sagte beispielsweise dieser Tage, die USA sollen Menschenrechtsfragen nicht an die Gewährung der Zoll vorteile nach der Meistbegünstigungsklausel knüpfen.
Allerdings ist die Sache mit den Menschenrechten nicht ganz einfach. Man versteht darunter ja ein ganzes Bündel verschiedener Grundfreiheiten: von der Religions- und Gewissensfreiheit bis zur Mitbestimmung des Staatswillens in der Demokratie, von der Freiheit zur wirtschaftlichen Initiative bis zum Briefgeheimnis.
Per Fischer hält in diesem Zusammenhang auch den Hinweis für wichtig, daß der Westen „Menschenrechte" nicht etwa den Chinesen „verkaufen" müsse. Es ist nämlich altchinesisches Traditionsgut, daß man auf Dauer nicht gegen das Volk regieren kann, daß Folter und Terror etwas Böses sind. Wer Gewehre auf unbewaffnete Stu-d e n t e n richtet, handelt gegen Prinzipien, die auf Konfuzius zurückgehen. Diese Prinzipien sind im Bewußtsein der chinesischen Intellektuellen bis heute sehr lebendig.
Vielleicht ist es geradezu kontraproduktiv, den Chinesen die Idee der Menschenrechte als westliche Humanitätsphilosophie aufdrängen zu wollen. Und vielleicht ist es auch sogar zu pauschal, wenn man meint, daß die Marktwirtschaft nur in Verbindung mit Demokratie funktioniert.
Der Wiener Wirtschaftswissenschaftler Erich Streissler betont, daß „freie Unternehmerwirtschaften" auch in politisch autoritären Gesellschaften blühten und blühen: im Reich der Kalifen von Bagdad ebenso wie im diktatorisch regierten Singapur, in absoluten Monarchien ebenso wie in konstitutionellen. Streisslermeint, daß die „Interdepenz derOrdnungen", also die gegenseitige Abhängigkeit von wirtschaftlicher und politischer Freiheit, in Wahrheit darauf hinausläuft, daß „Marktwirtschaft" nicht ohne rechtsstaatliche Ordnung bestehen kann. „Die Unternehmerschaft benötigt Rechtssicherheit, sie benötigt insbesondere Eigentumssicherheit, um langfristig planen zu können." Sie kann sich nicht entfalten, wenn die Gesellschaft unter dem Kommando eines bürokratischen Apparates steht.
Genau hier liegt wahrscheinlich auch die Schicksalsfrage für das chinesische Experiment. Kann eine kommunistische Parteidiktatur eine rechtsstaatliche Ordnung tolerieren, sich sogar als deren Hüter verstehen? Und sei es auch „nur für die Wirtschaft"? Ist das vorstellbar, wenn man sich vor Augen hält, daß gerade in kommunistischer Sicht die Rechtsordnung jederzeit zur Disposition der Führung steht? Ganz nach einem heute so, morgen vielleicht ganz anders definierten Partei-Interesse?
Vor 25 Jahren versuchten die Reformer in der damaligen Tschechoslowakei einen „Sozialismus mit menschlichem Antlitz" zu verwirklichen. Ihre Idee war, eine sozialgerechte Wirtschaft im Rahmen eines politischen Systems der Überzeugungsfreiheit und nicht unter der Leitung eines allmächtigen, repressiv regierenden Politbüros gedeihen zu lassen. Die Reformer in China scheinen das Umgekehrte zu wollen. Einen „Kapitalismus mit unmenschlichem Antlitz", nämlich auf der Grundlage der Verweigerung von politischer Freiheit.
Schlimmstenfalls könnte es also sein, daß Wirtschaftsdelegationen aus dem Westen jetzt dazu beitragen, das repressive System Pekings zu stützen, zu stabilisieren und seinen Ausbau zu fördern. So wie das jahrelang auch im Zeichen der Partnerschaft mit kommunistischen Eliten in Osteuropa passierte. Zur Verzweiflung der dortigen Dissidenten.