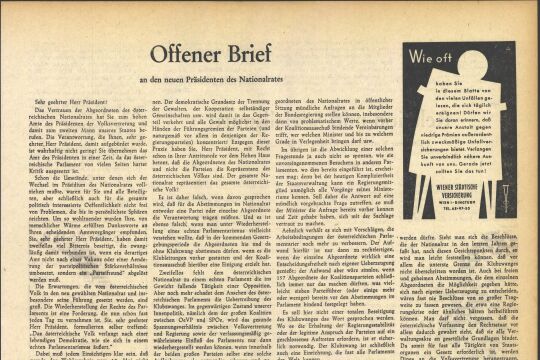Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Weg von den Alibifrauen
Die von Politikerfrauen angestrebte „Quotenregelung“ könnte leicht als Einzug des Biologismus in die Politik mißverstanden werden. Das Forcieren des Persönlichkeitswahlrechtes brächte wohl mehr demokratischen Fortschritt.
Die von Politikerfrauen angestrebte „Quotenregelung“ könnte leicht als Einzug des Biologismus in die Politik mißverstanden werden. Das Forcieren des Persönlichkeitswahlrechtes brächte wohl mehr demokratischen Fortschritt.
Die Einführung des passiven Wahlrechts für Frauen brachte im Jahr 1919 erstmals zehn weibliche Abgeordnete ins österreichische Parlament. Als eineinhalb Jahre später wieder gewählt wurde, hatten bereits elf Frauen Parlamentssitze erobert. Daß jedoch diese Zahl bis 1975 (!) einen nicht mehr erreichten Höchststand bilden sollte, ist — nicht nur aus Sicht engagierter Frauenpolitikerinnen — Beweis für die schneckenhafte Geschwindigkeit des Fortschritts. Zwar ist es in den Jahren seither ca. 20 Frauen gelungen, über ihre Parteien ins Parlament einzuziehen; zufrieden mit diesem Zustand sind am allerwenigsten die Wortführerinnen der politischen Frauenorganisationen.
Sie haben indes ein neues Schlüsselwort auf den Markt gebracht: die sogenannte „Quotenregelung“. Dieses nicht für viele verständliche Wortgebilde zielt darauf, die männliche Dominanz in den Gremien der repräsentativen Demokratie zu überwinden. Sollen doch nach den Vorstellungen der „Quoten“-Kämpferinnen bis zu 50 Prozent der Listenplätze den Frauen zuerkannt werden. (Dies begründet Dr. Marilies Flemming, ÖVP-Frauenchefin, mit dem Anspruch auf ein „Selbstvertretungsrecht der Mehrheit der Bevölkerung“.)
Der Quoten-Mechanismus soll sichtbar machen, daß die Mehrheit der Bevölkerung Frauen sind und daß unsere demokratische Gesellschaftsordnung, die auf angemessener Repräsentation der verschiedenen Bevölkerungsgruppen aufbaut, die statistisch findbaren Mehrheitsverhältnisse widerspiegelt.
Beinahe mit identischem Vokabular kämpfen die Frauenorganisationen der großen Parteien dieses Landes, deren Verbindendes ansonsten die Hervorhebung ihrer Unterschiede ist, für die Durchsetzung der Quotierung. Zunehmend geraten die Parteien unter Druck, mehr Frauen in die Parlamente zu wählen. Dabei dient der garantierte und verbriefte Mandatsanteil der Frauen den kämpferischen Frauenfunk-tionärinnen als Gradmesser für erreichte Gleichberechtigung in der praktischen Politik.
Auch den verknöchertsten Patriarchen hat sich inzwischen ins Bewußtsein gedrängt, daß dem gewachsenen Selbstbewußtsein der Frauen, wofür das ständig gestiegene Bildungsniveau nur ein Kennzeichen ist, auch in der Politik, die durch ihre Gremien inhaltliche und personelle Symbole setzt, berücksichtigt werden muß.
Die angepeilte Quotenregelung ist sicherlich nur ein instrumentales Vehikel, um dem gewandelten Status der Frau in dieser Gesellschaft auch formalen Ausdruck zu geben. Irisoferne ist diese Forderung eine nicht sehr spitze Waffe, weil sie momentan überzogen, ja überdreht wirkt.
Zu dieser Einsicht gelangte man selbst beim Frauenpolitischen Kongreß der CDU in Berlin 1984. Zu einem Dokument der CDU-Frauen (denen wenig später beim Bundesparteitag ihrer Partei ein Frauenpapier gelungen war, das die Gesamtpartei ziemlich durchbeutelte) hieß es: „Eine Quotierung kann kein geeignetes Mittel sein“ beim Bemühen der Parteien, Chancengleichheit für die Frauen durchzusetzen und vorhandene Rollenklischees zu überwinden.
Entscheidend ist, so die CDU-Frauen bei ihrem Berliner Kongreß, daß Vorurteile gegenüber Frauen in der Politik abgebaut werden und innerhalb der Parteien ein Klima geschaffen wird, das Frauen verstärkt motiviert, sich aktiver zu beteiligen. Die Forderung nach einer derzeit nur schwer nachvollziehbaren Quotenregelung mag ein wirksamer Beitrag sein, oft versteinerte Parteistrukturen aufzubrechen und nicht nur „Alibifrauen“ bzw. „Herzeigefrauen“ zu nominieren.
Entscheidend für die Berück-sichtigungfrauenspezifischer Anliegen im politischen Prozeß ist nicht so sehr die geschlechtsspezifisch motivierte Quotierung. Im Interesse der Frauen liegt es, daß ihre Probleme — soweit sie politisch lösbar sind — tatsächlich gelöst und nicht bloß diskutiert werden.
Ob die Erwartungen der Frauen, die die Mehrheit der Bevölkerung stellen, darauf setzen, daß Geschlechtsgenossinnen besser geeignet sind, sich für sie erfolgreich einzusetzen, dafür wäre ein ausgeprägtes Persönlichkeitswahlrecht ein verläßlicher Prüfstein.
Wenn der Wähler/die Wählerin „seinen“ Kandidaten bzw. „ihre“ Kandidatin direkt bestimmen kann, dann würde damit ein Prinzip der parlamentarischen Demokratie, das jedem Bürger und jeder Gruppe gleiche Chance auf Durchsetzung ihrer Interessen gibt, weiter gefestigt. Die „Quotenregelung“ also als Mittel, das Persönlichkeitswahlrecht wirksam werden zu lassen: das wäre ein positiver Aspekt der nicht leicht verständlichen Quoten-Forderung.
Was ansonsten leicht als Rückfall hinter das Zensuswahlrecht oder gar als Einzug des Biologismus in die Politik mißverstanden werden könnte, ließe sich dann als demokratischer Fortschritt interpretieren, weil selbständige Menschen als Wähler nicht mehr Parteien, sondern „ihre“ Repräsentanz wählen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!