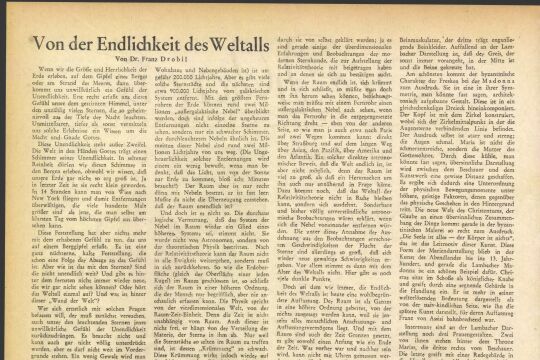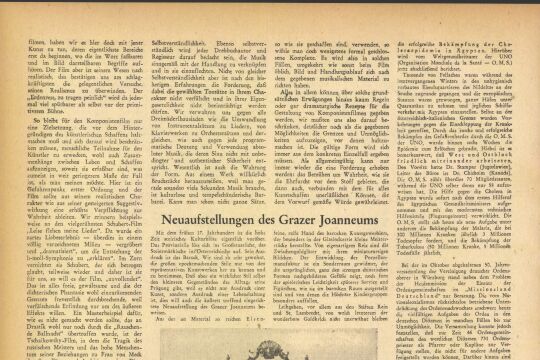Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Wegweiser zu Gott
Die Touristen, ie im Sommer durch die Berge Montenegros fahren oder über die Autobahn durch Serbien Richtung Ägäis, rollen achtlos an ihnen vorbei. Man muß wissen, wo sie zu finden sind, obwohl jede Straßenkarte sie verzeichnet, obwohl bescheidene Wegweiser auf sie aufmerksam machen.
Die Klöster der orthodoxen Mönche wurden nicht für den Trubel des 20. Jahrhunderts konzipiert, sie sind nicht auf Fremdenverkehr eingestellt. Sie sind Orte der Besinnung, der Einkehr, der Meditation — viele von ihnen seit tausend Jahren.
Und seit tausend Jahren im Wesentlichen unverändert ist ihr Schmuck: die Ikonen und Fresken. Sie sollen dem Gläubigen helfen, seinen Weg zu Gott zu finden.
„Du sollst dir kein Bildnis machen ..." verbot das Alte Testament im zweiten Buch Moses. Für die Griechen dagegen bedeuteten Götterbilder die materielle Stellvertretung des anzubetenden Gottes. Zwischen diesen Extremen entwickelte sich das Verhältnis der jungen Kirche zu bildlichen Darstellungen ihres Glaubenslebens.
730 nach Christus ließ der byzantinische Kaiser Leo III. alle Bilder der Heiligen aus Kirchen, Klöstern, und Wohnungen vernichten, obwohl die Päpste dagegen protestierten. Ein Jahrhundert später stellte das Konzil von Nicäa den Bilderkult wieder her.
Der Bilderstreit trug später, 1054, mit zur Trennung der oströmischen von der weströmischen Kirche bei. Im Westen, im Bereich der katholischen Kirche, wurde das Heils- und Heiligengeschehen zum wichtigsten Themenkomplex künstlerischer Aussage. Im Osten, bei den Orthodoxen zwischen Nowgorod und Byzanz, zwischen Armenien und Äthiopien, blieb die Ikonenmalerei integrierter Bestandteil des Kultes, an strenge Vorschriften für die Gestaltung wie für den Gestalter gebunden.
Der Ikonenmaler verstand sich nicht als Künstler. Er sah seine Aufgabe darin, dem Gläubigen durch das Bild das Gespräch mit
Gott zu erleichtern. Die persönliche Spiritualität des Malers verlieh dem Bild jenen Hauch von Transparenz, der den Betrachter noch heute so betroffen macht.
Vom Ikonenmaler verlangte die Synode von Moskau 1551 „Demut, Sanftheit und Frömmigkeit", er sollte „weder rauben, noch stehlen, noch trinken". Und das Malerhandbuch vom Berg Athos, wo russische, serbische, griechische und bulgarische Mönche ihre Klöster errichteten und so auch ihre künstlerischen Akzente austauschen konnten, schrieben dem Ikonenmaler vor, am Beginn seiner Tätigkeit „vor einem Bild der Gottesmutter Hodigitria zu Christus um Vergebung seiner Sünden zu flehen".
„I Hodigitria", die Wegweiserin, ist eine der wichtigsten Darstellungen der Gottesmutter; eine der bekanntesten ist die Madonna von Tschenstochau. Der Legende nach habe der Evangelist Lukas die Muttergottes gemalt und damit den Urtyp aller Marienikonen geschaffen. Damit aber wird auch Lukas als Maler zu einem immer wiederkehrenden Motiv der Ikonenmaler.
Die Klöster Moraca in Montenegro, Pec, Decani, Gra-canica im Kosovo Manasija und Ravanica im östlichen, Zica im mittleren Serbien stammen aus der Zeit der Nemanjidenherr-scher und der autonomen serbischen Kirche nach dem 12. Jahrhundert. Sie haben nicht nur den Türkensturm überstanden, sondern auch alle weiteren Kriege bis zu den Partisanenkämpfen vor 40 Jahren, die so vieles in diesem Gebiet in Schutt und Asche legten.
Uber hundert Exponate, Ikonen vor allem, aber auch abgenommene Fresken sowie Kultgegenstände aus dem gottesdienstlichen Gebrauch aus den Beständen des Nationalmuseums in Belgrad, aber auch direkt aus den wichtigsten Klöstern dieses Raums, sind nun bis nach Weihnachten im Wiener
Völkerkundemuseum zu sehen.
Die Stiftung „Pro Oriente" in Wien hatte die Initiative für diese Ausstellung ergriffen. Das jugoslawische Kultur- und Informationszentrum in Wien hat sie schließlich ermöglicht.
Ikonen sind nicht zum ersten Mal in Wien zu sehen. Äthiopische, bulgarische, georgische wurden in den vergangenen Jahren hier gezeigt, russische in Herzogenburg. Die serbischen sind — in dieser Reichhaltigkeit - zum ersten Mal da. Sie laden ein, sich ihrer Suggestivkraft hinzugeben, sich näher mit ihrer Aussage zu beschäftigen, wo jede Handhaltung, jede Randfigur ihre Symbolbedeutung besitzt; wo das Licht mit den Aussagen des Alten oder des Neuen Testamentes korrespondiert, ob bei der Darstellung von Christi Geburt oder bei Christus dem Pantokrator.
„... sende Deinen heiligen Segen auf diese Ikone und gib ihr Kraft, alle Krankheiten und Leiden zu heilen ...", hieß es einst im Weiheritus, mit dem das fertige Bild erst zur Ikone wurde. Für den orthodoxen Christen gilt dieser Wesensinhalt des Bildes noch heute.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!