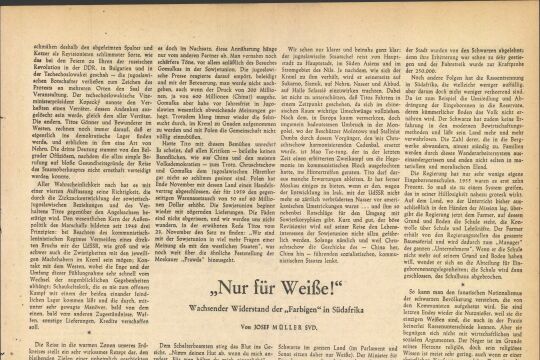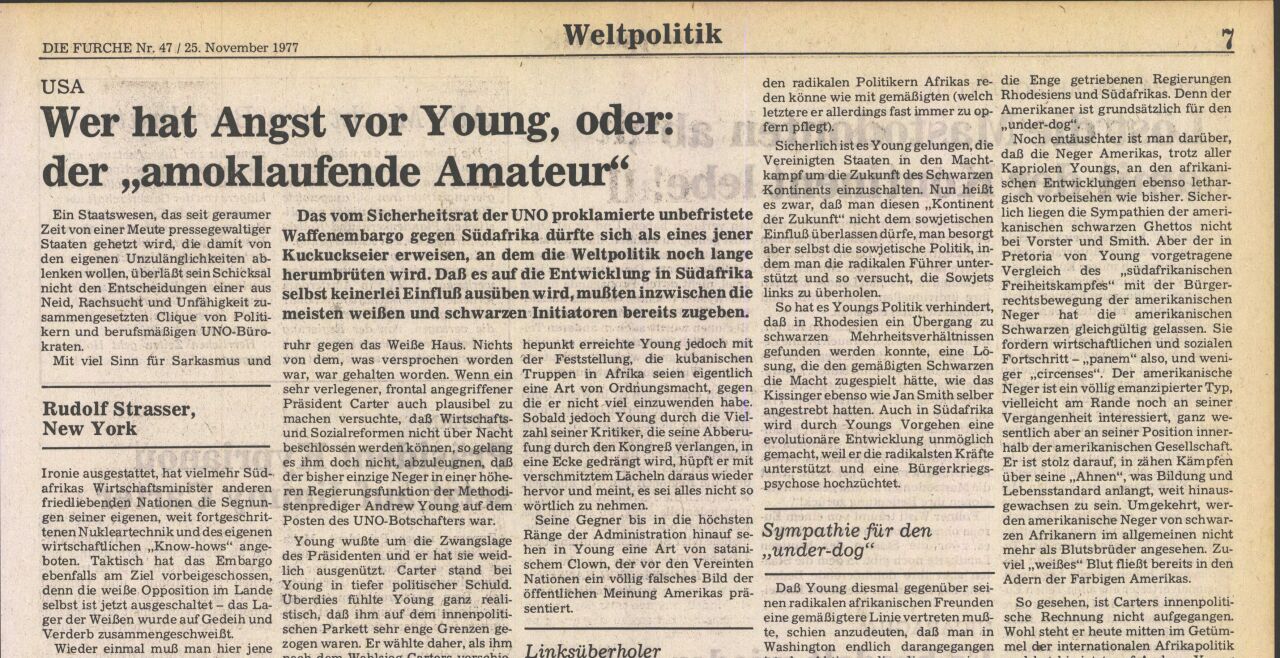
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Wer hat Angst vor Young, oder: der „amoklaufende Amateur”
Das vom Sicherheitsrat der UNO proklamierte unbefristete Waffenembargo gegen Südafrika dürfte sich als eines jener Kuckuckseier erweisen, an dem die Weltpolitik noch lange herumbrüten wird. Daß es auf die Entwicklung in Südafrika selbst keinerlei Einfluß ausüben wird, mußten inzwischen die meisten weißen und schwarzen Initiatoren bereits zugeben.
Das vom Sicherheitsrat der UNO proklamierte unbefristete Waffenembargo gegen Südafrika dürfte sich als eines jener Kuckuckseier erweisen, an dem die Weltpolitik noch lange herumbrüten wird. Daß es auf die Entwicklung in Südafrika selbst keinerlei Einfluß ausüben wird, mußten inzwischen die meisten weißen und schwarzen Initiatoren bereits zugeben.
Ein Staatswesen, das seit geraumer Zeit von einer Meute pressegewaltiger Staaten gehetzt wird, die damit von den eigenen Unzulänglichkeiten ablenken wollen, überläßt sein Schicksal nicht den Entscheidungen einer aus Neid, Rachsucht und Unfähigkeit zusammengesetzten Clique von Politikern und berufsmäßigen UNO-Büro- kraten.
Mit viel Sinn für Sarkasmus und Ironie ausgestattet, hat vielmehr Südafrikas Wirtschaftsminister anderen friedliebenden Nationen die Segnungen seiner eigenen, weit fortgeschrittenen Nukleartechnik und des eigenen wirtschaftlichen „Know-hows” angeboten. Taktisch hat das Embargo ebenfalls am Ziel vorbeigeschossen, denn die weiße Opposition im Lande selbst ist jetzt ausgeschaltet - das Lager der Weißen wurde auf Gedeih und Verderb zusammengeschweißt.
Wieder einmal muß man hier jene amerikanischen Wählerschichten analysieren, die Präsident Carter in das Weiße Hau? gebracht haben. Ein ungewöhnlich hoher Prozentsatz schwarzer Stimmen war für den Wahlausgang entscheidend. Versprochen wurde den Schwarzen im Wahlkampf so ziemlich alles, was ihnen attraktiv erscheinen mochte: Sanierung der Ghettos und der bankrotten Städte, Abbau der bei den Negern überdurchschnittlich hohen Arbeitslosigkeit, Steuer- und Sozialreformen, und nicht zuletzt eine stärkere Vertretung in den höchsten Gremien der Verwaltung.
Jedoch - bereits sechs Monate nach Regierungsantritt Carters stand das Lager der Schwarzen im hellen Aufrühr gegen das Weiße Haus. Nichts von dem, was versprochen worden war, war gehalten worden. Wenn ein sehr verlegener, frontal angegriffener Präsident Carter auch plausibel zu machen versuchte, daß Wirtschaftsund Sozialreformen nicht über Nacht beschlossen werden können, so gelang es ihm doch nicht, abzuleugnen, daß der bisher einzige Neger in einer höheren Regierungsfunktion der Methodistenprediger Andrew Young auf dem Posten des UNO-Botschafters war.
Young wußte um die Zwangslage des Präsidenten und er hat sie weidlich ausgenützt. Carter stand bei Young in tiefer politischer Schuld. Überdies fühlte Young ganz realistisch, daß ihm auf dem innenpolitischen Parkett sehr enge Grenzen gezogen waren. Er wählte daher, als ihm nach dem Wahlsieg Carters verschiedene Kabinettsposten angeboten wurden, die Funktion eines UNO-Botschafters mit Kabinettsrang und erhandelte sich von Carter freie Hand bei der Verfolgung seiner außenpolitischen, vor allem in Schwarzafrika befindlichen Ziele.
Es folgte eine Periode, in der Young die im diplomatischen Alltag verstrickte Welt oft mehrmals an einem Tage so schockierte, daß alsbald eine Welle der Empörung gegen ihn anbrandete. Seine Erklärungen waren entweder falsch oder so extrem, daß das State-Department gar nicht mehr nachkam, sie zu „interpretieren” oder zu verniedlichen. Einen traurigen Höhepunkt erreichte Young jedoch mit der Feststellung, die kubanischen Truppen in Afrika seien eigentlich eine Art von Ordriungsmacht, gegen die er nicht viel einzuwenden habe. Sobald jedoch Young durch die Vielzahl seiner Kritiker, die seine Abberufung durch den Kongreß verlangen, in eine Ecke gedrängt wird, hüpft er mit verschmitztem Lächeln daraus wieder hervor und meint, es sei alles nicht so wörtlich zu nehmen.
Seine Gegner bis in die höchsten Ränge der Administration hinauf sehen in Young eine Art von satanischem Clown, der vor den Vereinten Nationen ein völlig falsches Bild der öffentlichen Meinung Amerikas präsentiert.
Carter jedoch sieht in Young einen unkonventionellen Diplomaten, dem es in den zurückliegenden Monaten gelungen ist, Amerika in Schwarzafrika wieder glaubwürdig zu machen und dem es dabei gleichgültig ist, wie man in London, Bonn oder Paris über ihn denkt. Nach Carters Ansicht hätten alle bisherigen weißen UNO-Botschaf- ter, selbst die progressivsten, versagt, weil sie als Angehörige des weißen Establishments gegenüber den schwarzen Frontstaaten Afrikas nicht legitimiert gewesen, seien. Der Neger Young sei hingegen der erste UNO- Vertreter Amerikas, der ebenso mit den radikalen Politikern Afrikas reden könne wie mit gemäßigten (welch letztere er allerdings fast immer zu opfern pflegt).
Sicherlich ist es Young gelungen, die Vereinigten Staaten in den Machtkampf um die Zukunft des Schwarzen -Kontinents einzuschalten. Nun heißt es zwar, daß man diesen „Kontinent der Zukunft” nicht dem sowjetischen Einfluß überlassen dürfe, man besorgt aber selbst die sowjetische Politik, indem man die radikalen Führer unterstützt und so versucht, die Sowjets links zu überholen.
So hat es Youngs Politik verhindert, daß in Rhodesien ein Übergang zu schwarzen Mehrheitsverhältnissen gefunden werden konnte, eine Lösung, die den gemäßigten Schwarzen die Macht zugespielt hätte, wie das Kissinger ebenso wie Jan Smith selber angestrebt hatten. Auch in Südafrika wird durch Youngs Vorgehen eine evolutionäre Entwicklung unmöglich gemacht, weil er die radikalsten Kräfte unterstützt und eine Bürgerkriegspsychose hochzüchtet.
Daß Young diesmal gegenüber seinen radikalen afrikanischen Freunden eine gemäßigtere Linie vertreten mußte, schien anzudeuten, daß man in Washington endlich darangegangen ist, den Aktionsradius dieses - wie es ein Kritiker ausdrückte - „amoklaufenden Amateurs” einzuschränken. Nicht nur ist bis jetzt für die Vereinigten Staaten außenpolitisch wenig dabei abgefallen; was aber auch Präsident Carter besonders zu schmerzen scheint, ist, daß er von dieser neuen Afrikapolitik innenpolitisch noch weniger profitiert hat. Man hatte mit Desinteressement im weißen Lager Amerikas gerechnet, weil die Mehrzahl der Amerikaner an Fragen der Außenpolitik überhaupt wenig Interesse nimmt, wenn ihr unmittelbarer Lebensbereich davon nicht betroffen ist. Statt dessen entwickelt sich jetzt eine Grundwelle der Sympathie für die in die Enge getriebenen Regierungen Rhodésiens und Südafrikas. Denn der Amerikaner ist grundsätzlich für den „under-dog”.
Noch entäuschter ist man darüber, daß die Neger Amerikas, trotz aller Kapriolen Youngs, an den afrikanischen Entwicklungen ebenso lethargisch vorbeisehen wie bisher. Sicherlich liegen die Sympathien der amerikanischen schwarzen Ghettos nicht bei Vorster und Smith. Aber der in Pretoria von Young vorgetragene Vergleich des „südafrikanischen Freiheitskampfes” mit der Bürgerrechtsbewegung der amerikanischen Neger hat die amerikanischen Schwarzen gleichgültig gelassen. Sie fordern wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt - „panem” also, und weniger „circenses”. Der amerikanische Neger ist ein völlig emanzipierter Typ, vielleicht am Rande noch an seiner Vergangenheit interessiert, ganz wesentlich aber an seiner Position innerhalb der amerikanischen Gesellschaft. Er ist stolz darauf, in zähen Kämpfen über seine „Ahnen”, was Bildung und Lebensstandard anlangt, weit hinausgewachsen zu sein. Umgekehrt, werden amerikanische Neger von schwarzen Afrikanern im allgemeinen nicht mehr als Blutsbrüder angesehen. Zuviel „weißes” Blut fließt bereits in den Adern der Farbigen Amerikas.
So gesehen, ist Carters innenpolitische Rechnung nicht aufgegangen. Wohl steht er heute mitten im Getümmel der internationalen Afrikapolitik und hat bis jetzt, auf Andrew Young hörend, geglaubt, Amerikas Großmachtsanspruch zu vertreten, wenn er die radikalen Forderungen afrikanischer Extremisten unterstützt. Aber es fehlt ihm und seinem aus der tiefen Provinz Georgias stammenden Team das Format, die Erfahrung und die Erkenntnis, daß es für viele Probleme keine synthetischen Lösungen gibt und daß es für alle Teile besser ist, der natürlichen Evolution ihren ohnedies raschen, freien Lauf zu lassen. Im Endeffekt diktieren ja doch interne Notwendigkeiten den Kurs der Außenpolitik und nicht stilistische Kapriolen, die am Ende niemand mehr erst nimmt.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!