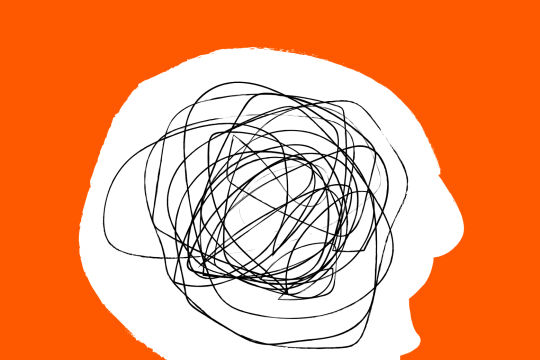Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Wer hat es nicht gewußt?
Der Autor weiß, wovon er schreibt: Er hat seinen Zivildienst im Pflegeheim Lainz versehen - und dabei Zustände und Schicksale kennengelernt, die ihn nicht mehr loslassen.
Der Autor weiß, wovon er schreibt: Er hat seinen Zivildienst im Pflegeheim Lainz versehen - und dabei Zustände und Schicksale kennengelernt, die ihn nicht mehr loslassen.
Seit Jahren ist die Misere in Österreichs Spitälern und Pflegeheimen bekannt. Eklatanter Personalmangel, chronische Bettennot, Patienten, die sich nicht verstanden fühlen und lästig werden, so empfindet dies zumindest das Pflegepersonal.
Seit Jahren warten Beobachter der Spitalsszene in Österreich auf die Katastrophe. Nun gibt es sie wirklich. Nicht einmal beschwichtigende Worte können über das Desaster hinwegtäu-
schen. Die einzig offene Fraje ist: Wie viele Patienten wurden tatsächlich von den vier „Todesengeln“ umgebracht? Die zwangsläufig dazukommende Uberle-gimg lautet: Auf wie vielen anderen Stationen sind ebenfalls Menschen zu Tode gekommen, nicht durch vorsätzlichen Mord, sondern durch seelische Grausamkeit?
Vor mehreren Jahren versah ich meinen Zivildienst im Pflegeheim Lainz. Nie zuvor und nie danach sah ich Menschen, die von der Gnade anderer derartig abhängig waren:
Gehbehinderte, Blinde, Verwirrte, die nicht wußten, ob Tag oder Nacht ist, Menschen, die lachten, weil sie frühstücken mußten, obwohl sie meinten, das Nachtmahl wäre jetzt wohl angebracht, Alkoholiker, die nichts mehr essen konnten, Patienten, die durch Gehirnschlag das Sprechen verlernt hatten, ihre Identität verloren hatten und im wahrsten Sinn des Wortes zu unschuldigen Kindern geworden waren.
Solche Patienten sind nicht einfach zu behandeln. Inmitten ihrer Verwirrung kann es vorkommen, daß sie für wenige Minuten voll und ganz verstehen, plötzlich wissen, in welcher Situation sie sind. Niemand weiß, wann solche „hellen Augenblicke“ sind, dafür sind in diesen Momenten die Möglichkeiten zu seelischen Verletzimgen besonders groß.
Ein Pflegepersonal, das unim-terbrochen überfordert ist - wie sollen sich zwei, drei Schwestern und Pfleger einimdvierzig Patienten menschlich behutsam Tag für Tag, Nacht für Nacht nähern? -, wird und muß fast zwangsläufig versagen. Nicht grundlos ist die. durchschnittliche Dauer der Berufsausübung einer Krankenschwester fünf Jahre. Der Bedarf an Pflegepersonen ist so groß, daß Stationsgehilfen einspringen müssen. Und wenn sich angesichts der aktuellen Situation Politiker und Journalisten in trauter Eintracht entsetzt darüber zeigen, daß Stationsgehilfen Injektionen geben, dann bleibt nur die Frage: Wo haben sie die letzten Jahre gelebt?
Gäbe es in den Pflegeheimen und Spitälern wirklich nur mehr Dienst nach gesetzlichen Bestimmungen, dann würde vielen überhaupt nicht mehr geholfen werden können. Subkutan imd intramuskulär wiu-de von Stationsge-
hilfen seit Jahr und Tag gespritzt Nicht intravenös, das dürfen streng genommen nicht einmal die diplomierten Krankenschwestern, sondern nur die Ärzte.
Und doch: Die Gemeinde Wien bildet Krankenschwestern aus und läßt es zu, daß diese auch intravenös spritzen können. Begründung: In der Praxis wird die Kenntnis wichtig sein, weil die Ärzte allein die anfallende Arbeit nicht schaffen würden. Kündigt sich da nicht ein neuer Skandal an?
Wahrscheinlich ist das Problem gar nicht, wer was wo wem spritzen darf. Das Problem ist die psychische Verlassenheit der Pflegepersonen. Es gibt keine Mechanismen, die zeitgerecht erkennen lassen, daß ein Mitglied des Pflegepersonals oder ein Arzt psychisch ins Trudeln gerät. Vorschläge aus aktuellem Anlaß, daß mehr psychologische Schulimgen vorgenommen werden sollen, sind ebenso lächerlich unzureichend wie die Anreicherung des Lehrplans für angehende Pflegepersonen damit, was Ich, Uber-Ich und Es bedeuten. Damit fängt niemand in der Praxis etwas an. Es ist auch vöUig unsinnig, ein Fortbildungsseminar im Mai gehabt zu haben, wenn das Problem mit einem Patienten im November akut wird.
Die einzige Alternative kann nur lauten: Einführung inPsychologie, warum nicht, doch wichtiger ist die permanente Aufsicht, die ständige begleitende Kontrolle über die Prozesse, die im Inneren ablaufen.
Hätte es die Begleitxmg gegeben, wären die Schwestern in Lainz nicht allein gewesen, hätte es mit Sicherheit keine sieben Jahre gegeben, in denen es möglich gewesen wäre, sich als Herrin über Leben und Tod zu fühlen. Voraussetzung ist allerdings eine funktionierende Aufsicht; entspricht die begleitende Kontrolle jenen KontroUmechanismen, die in Lainz üblich sind, dann kann sie ohnehin unterbleiben.
Die Arbeit des Pflegepersonals wird nämlich so überwacht: Der Kontrollor kündigt sich an, indem mitgeteilt wird, er kommt am Dienstag \xm 11 Uhr auf die Station. Merkwürdig genug: es ist meist alles bestens.
Geht man von der Voraussetzung aus, daß Schwerstkranke, Alte und geistig Behinderte zu den gesellschaftlich an den Rand Gedrängten gehören und die gesamte Last der Versorgimg einer Gruppe aufgehalst wird, die an dem Marginalisierungsprozeß selbst ununterbrochen beteiligt ist, wird deutlich, daß die tJber-fordenmg gegeben ist.
Die Pflegepersonen, häufig durch den zweiten Bildvmgsweg in diesen Beruf geraten, sehen zu wenig Erfolgserlebnisse. Da darf man sich dann auch nicht wundem, wenn „Sicherungen durchbrennen“.
Auch wenn kein Zweifel an der Schwere imd an der Schrecklichkeit der Verbrechen gelassen wird, muß deutlich werden: Das Problem ist nicht dadurch gelöst, daß man vier „eiskalte Mörderinnen“ aburteilt, sondern daß man dringend Reformen in die Wege leitet. Dazu gehören nicht nur Aufsicht, Anpassung der gesetzlichen Bestimmungen an die Wirklichkeit und umgekehrt, sondern auch die Möglichkeit, daß Pflegepersonen Erfolgserlebnisse haben. Als letzte Konsequenz wird eine Abschaffung der unüberschaubaren Großstrukturen von Krankenhäusern und Pflegeheimen unabdingbar sein.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!