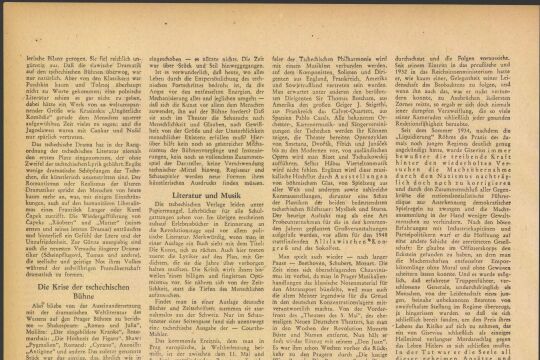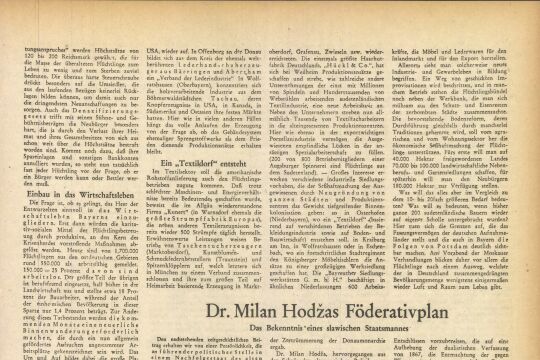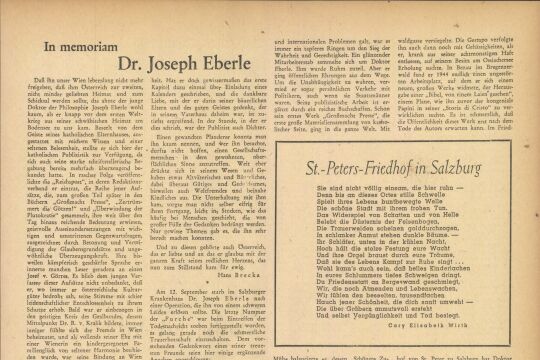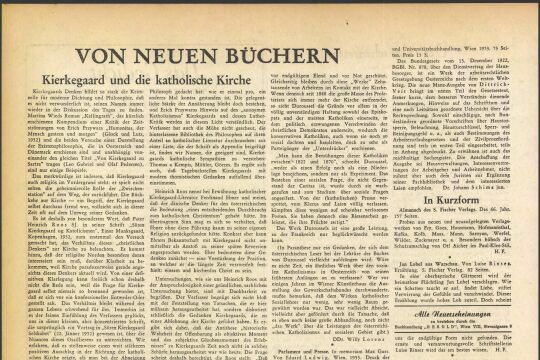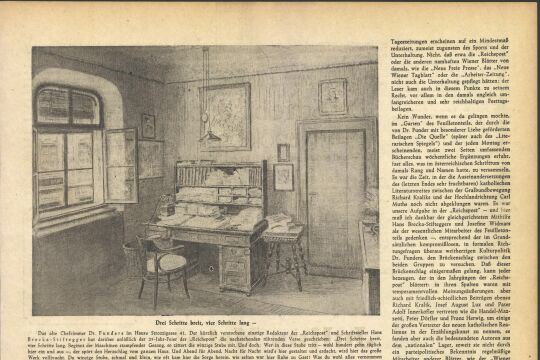Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Wer traut sich, Steine auf sie zu werfen ?
Können heutige katholische Journalisten aus der Situation ihrer Kollegen in den dreißiger Jahren und speziell im März 1938 etwas lernen? Um dieses Lernen ging es bei einem Studientag Ende Februar in Wien.
Können heutige katholische Journalisten aus der Situation ihrer Kollegen in den dreißiger Jahren und speziell im März 1938 etwas lernen? Um dieses Lernen ging es bei einem Studientag Ende Februar in Wien.
Die katholische Presse Österreichs war in den dreißiger Jahren in einem relativ ansehnlichen Zustand. Friedrich Funder nennt 1931 13 Tageszeitungstitel und 50 Wochenblätter von recht verschiedener Funktion, mehrheitlich jedoch Informationswochenzeitungen, die dem heutigen Typ „Niederösterreichische Nachrichten (NÖN)“ oder „Ober-österreichische Rundschau“ entsprechen. Von der deutschen katholischen Presse unterschied sich die österreichische durch ein auffälliges Strukturmerkmal: Sie stand fast zur Gänze im Eigentum katholischer Preßvereine, die in den Jahren zwischen 1869 und 1908 entstanden waren.
Funder lobt die Preßvereins-konstruktion als „ein von allen Fährlichkeiten und Unsicherheiten des privaten Besitzes befreites Fundament“. Es half der katholischen Presse „Krisen überstehen, denen private Verleger schwerlich gewachsen gewesen wären“. Freilich wurde so auch manche Kümmer-Existenz verschleiert, und gegen die nationalsozialistische Pressepolitik stellten die Vereine schon gar keinen Schutz dar. Sie wurden 1938 ohne Zögern teils aufgelöst, teils durch nationalsozialistische Vereinsgründungen unterlaufen, geänderten Satzungen unterworfen oder zwangsaufgekauft. Die Rückstellungsverfahren zogen sich teilweise bis in die Mitte der fünfziger Jahre hin.
Daß die Nationalsozialisten mit den katholischen Zeitungen 1938 in der Regel kurzen Prozeß machen konnten, lag jedoch nicht, wahrscheinlich nicht einmal in erster Linie an der einheitlichen Preßvereinsstruktur, die natürlich leichter zu ergreifen war als die vielfältigen Konstruktionen der Presse im Altreich. Vielmehr konnten die einfallenden NS-Funktionäre auf mittlerweile fünfjährige Erfahrungen mit der Presselenkung zurückgreifen und zusätzlich auf ihre österreichischen „U-Boote“, die als Experten für die meist schon am 12. März erfolgende Übernahme der Betriebe bereitstanden. Die Übernahme spielte sich mit bemerkenswertem Zynismus ab, wobei freilich viele Einzelheiten noch ungeklärt sind.
Warum zum Beispiel wurde die „Salzburg Chronik“ sofort in „Salzburger Zeitung“ umbenannt, während an anderen Orten die Titel beibehalten wurden? In Salzburg wie in anderen Redaktionen durften nicht nur, sondern mußten vorerst einmal die Redakteure bleiben, sich auf die neue Linie festlegen; sie konnten aber dennoch folgende Sätze in der Ausgabe vom 12. März publizieren:
„Der Wandel der Dinge, der seit den Abendstunden des gestrigen Tages eingetreten ist, bringt es mit sich, daß unser Blatt heute unter einem neuen Titel erscheint. (...) Jede Zeit verlangt nach Aufbauarbeit, auch die neue, in die wir jetzt eingetreten sind. Dieser Aufbauarbeit zu dienen, den religiösen und sittlichen Grundsätzen getreu, die wir immer vertreten haben, wird der Zweck unseres Blattes sein. Wir rechnen auch für die Zukunft wie bisher mit der Treue unserer Leser, mit denen uns zumeist schon langjährige Gesinnungsgemeinschaft aufs herzlichste verbindet.“
Diese „Gesinnungsgemeinschaft“ war freilich in jenen Tagen nicht intakt. „Hoffend, es sei nicht das Böse“, hieß die Spitze den „Garanten“ deutscher Bürgerlichkeit willkommen, während die katholische Tagespresse von einem Tag auf den anderen aufhörte, katholisch zu sein, und ihre Chefredakteure festgesetzt wurden.
Bis 30. Juni hatte sich, wer in Osterreich Journalist bleiben wollte, beim „Reichsverband der deutschen Presse, Landesverband Ostmark“ anzumelden... Die im Sinne des Nationalsozialismus „Zuverlässigen“ durften weiterschreiben, die poütischen Gegner und eindeutigen NichtArier in der Regel nicht. Aber die Regel kannte Ausnahmen: Paragraph 9 des Schriftleiterg^setzes eröffnete selbst Nicht-Ariern die Aussicht auf Ausnahmebewilligungen. Sie konnten 1938 nur noch „Mischungen“ erteilt werden. Günstig für die Antragsteller wirkte sich aus, „wenn sie im Weltkrieg an der Front für das Deutsche Reich oder seine Verbündeten gekämpft haben oder wenn ihre Väter oder Söhne im Weltkrieg gefallen sind“...
Es hatte eben alles seine Ordnung, und wer arbeiten wollte und vielleicht noch eine Familie zu ernähren hatte, der schrieb seine Beitrittserklärung und argumentierte, wie es ihm die Hoffnung auf die Ausnahmebewilligung diktierte. Oskar Maurus Fontana (1889 bis 1969) konnte sich auf die Frontkämpfer-Klausel berufen. Beim Ansuchen auf Erhöhung seiner Offizierspension — er hatte zunächst Schreibverbot - half sie ihm nichts, und dies, obwohl er im Juli 1939 für sich vorbringen konnte, „daß ich mit Bewilligung des Herrn Reichspropagandaministers meinem journalistischen Beruf nachgehen und damit für die hohen Ziele der Volksgemeinschaft tätig sein darf - eine Aufgabe, der ich mich freudig und mit dem Einsatz meiner besten Kräfte zum Wohle des Ganzen unterziehe“.
Wer traut sich, Steine auf ihn zu werfen? Und wer auf den „Reichspost“- und späteren „Volksblatt“-Redakteur Leopold Husinsky (1890 bis 1951), der als „MischUng ersten Grades (zwei jüdische Großeltern)“ nicht in den Reichsverband aufgenommen und dem am 3. Februar 1939 auch sein Ausnahmeantrag abgelehnt wird. Er hatte, wie man meinen könnte, starke, Argumente eingebracht: sechs minderjährige Kinder und eine „Auswahl selbstverfaßter antimarxistischer und antisemitischer Artikel aus den Jahren 1929 bis 1938“.
So mancher März-Verhaftete hätte ebenso viel oder noch mehr Einschlägiges vorlegen können, aber der direkte Zugriff des Terrors schützte ihn vor dem bürgerlichen Kompromiß, den zu versuchen doch eigentlich ganz normal und vernünftig war, wenn einer eine Sechs-Kinder-Familie zu versorgen hatte. Insofern ist Hu-sinskys Lebenslauf ein Beispiel zugleich für den Aspekt der Normalität wie für den Aspekt des Terrors, der ihm in sieben Zeilen Berufsverbot erteilte, weil er zwei unpassende Großeltern hatte. Zur Normalität in Husinskys Berufsweg gehört übrigens auch, daß er auf katholischem Boden antisozialistisch und antisemitisch publiziert hat,..
Für den Wissenschaftler stellt sich hier die meines Erachtens noch offene Frage, ob, und wenn ja, warum die katholische Publizistik der Ersten Republik auf dem Felde von Antimarxismus und Antisemitismus stets kritischer und polemischer operierte, als wenn es um Warnung vor dem Nationalsozialismus ging.
Der Autor ist Vorstand des Instituts für Publizistik an der Universität Salzburg. Auszug aus seinem Referat am 27. 2.1988 im Wiener Europahaus.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!