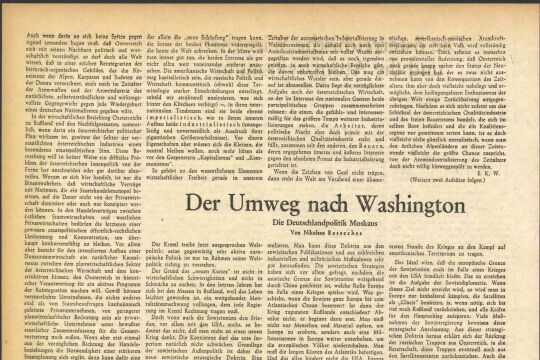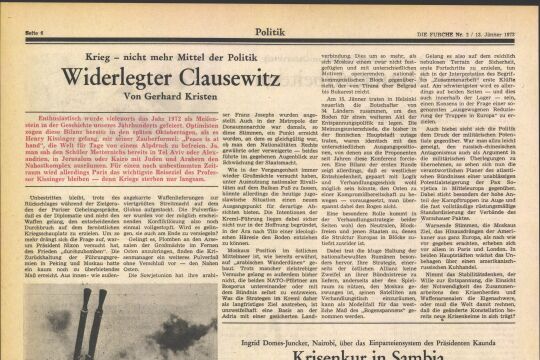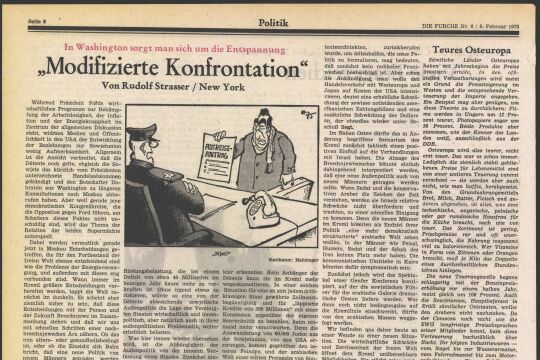Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Widerborstige Verbündete
„Kanzler Schmidt - der Macher": ein Image, das ebenso wie die linksliberal orientierten Medien in der Bundesrepublik Deutschland die großen Zeitungen und Fernsehstationen der Vereinigten Staaten dem westdeutschen Bundeskanzler gerne anhängten.
Die Zeiten haben sich geändert: Vom Macher-Image des Kanzlers ist inzwischen auch in der BRD schon einiges abgebröckelt, schon gar ist nach Ansicht vieler Amerikaner aus dem deutschen „Macher" eigentlich ein „trou-ble-maker" geworden, einer, der ihnen Schwierigkeiten macht.
Helmut Schmidt hat dies bei seinem letztwöchigen Aufenthalt in Washington selbst zu spüren bekommen, nicht zuletzt auch deshalb, weil seinem inoffiziellen Besuch einige ungewöhnlich scharfe publizistische Stellungnahmen vorausgegangen waren:
Joseph Kraft etwa, ein bekannter politischer Kolumnist, forderte in einem Artikel, daß die USA mit dem westdeutschen Kanzler „Klartext" sprechen müßten, damit Schmidt den Sinn der NATO-Verteidigungsverpflichtungen,"die amerikanische Vorsicht gegenüber der sowjetischen Politik und die Rückendeckung Washingtons für den Camp-David-Prozeß endlich einmal verstehen lerne.
Und Howard Baker, Führer der künftigen republikanischen Mehrheit im Senat, platzte kurz vor Schmidts Eintreffen in den USA mit einem „Status-Report" über die NATO an die Öffentlichkeit:
Der Senator aus Tennessee beklagte darin die „unterschiedlichen Auffassungen", die zwischen Bonn und Washington über die „Ziele der sowjetischen Politik, über die Kriterien, nach denen ihre Sicherheitspolitik' einzuschätzen ist, sowie über den Grad der Bedrohung, den sie für die westliche Allianz darstellt," herrschen würden.
Der Unmut, dem da Kommentatoren und Politiker öffentlich Luft machten, richtete sich vielleicht weniger gegen Schmidt und die Deutschen (deren bisherige Leistungen im Rahmen des NATO-Bündnisses von den Amerikanern unbedingt anerkannt werden), sondern gegen die Politik der europäischen Alliierten der USA im allgemeinen.
Warum diese Verärgerung? Man muß sich zuerst einmal vor Augen halten, was in letzter Zeit alles passiert ist: die Iran-Krise, die die Supermacht Amerika ohnmächtig mitverfolgen mußte; die sowjetische Wühlarbeit in der Dritten Welt (Südostasien, Angola, Äthiopien, Jemen), der Washington nicht entgegenwirken konnte oder wollte; schließlich die offene militärische Intervention der Sowjets in Afghanistan, die aller Welt die Entschlossenheit und Aggressivität der kommunistischen Gegenspieler Washingtons im Kreml drastischer denn je zeigte.
Dazu kommen weitere Krisenherde, die die Amerikaner zutiefst beunruhigen, zumal sie als Brandstifter im Hintergrund mehr oder weniger immer die Sowjets vermuten (was die Europäer ja nicht unbedingt tun): der Persische Golf, Südafrika, die Karibik, Mittelamerika, Polen.
Daß die europäischen Verbündeten
Washingtons, ja auch die befreundeten demokratischen Staaten in Europa die sowjetische Gefahr nicht ebenso einzuschätzen bereit waren und sind wie die USA, den amerikanischen Aufrufen zu Sanktionen und Olympiaboykott gegen die Sowjetunion im Gefolge derer Afghanistan-Invasion nur halbherzig -wenn überhaupt - folgten; daß Schmidt und Giscard d'Estaing schließlich in Eigenregie zu Breschnew pilgerten - all dies verstörte die US-Öffentlichkeit in hohem Maße.
Die stark empfundene Machtlosigkeit gegenüber Entwicklungen in der Dritten Welt und der aggressiven sowjetischen Politik, die eher düstere Zukunftsperspektive in dieser Hinsicht sowie die Widerborstigkeit der Verbündeten - diese Dinge haben in der amerikanischen Öffentlichkeit einen fundamentalen Meinungsumschwung herbeigeführt.
Michael Getier, Wehrexperte der „Washington Post," deutete in einem Gespräch mit der FURCHE diese Entwicklung: „In den USA hat sich bei einem breiten Teil der Bevölkerung die Meinung durchgesetzt, daß Washington in der Weltpolitik wieder aktiver werden sollte; das heißt nicht aggressiver -jedoch sollten wir unser Schicksal endlich wieder selbst in die Hand nehmen und zu kontrollieren versuchen."
In dieses Bild des Strebens nach einer wiederbelebten amerikanischen Aktivität in der Weltpolitik paßt die Zauderei der europäischen NATO-Alliierten natürlich ganz und gar nicht. Daß neben Belgien, Dänemark und den Niederlanden nun auch die Bundesrepublik und Großbritannien die 1978 eingegangene Verpflichtung nicht erfüllen können oder wollen, ihre Wehrbudgets jährlich um real drei Prozent zu erhöhen, macht in den USA jedenfalls zusehends böses Blut.
Für den Amerikaner stellt sich diese Sache nämlich relativ einfach dar: Die Europäer sind reicher geworden, also sollen sie auch mehr für ihre eigene Verteidigung tun und nicht alles den USA aufbürden!
Das europäische Argument von zunehmenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten und erhöhten staatlicheri Sozialleistungen wird man in Washington kaum gelten lassen: Wirtschaftliche Probleme haben die Amerikaner selber genug, schon gar soziale (man denke an die Großstadtslums, an die enormen Probleme mit ethnischen Bevölkerungsgruppen wie Schwarzen und Hispanie-ren, in jüngster Zeit vor allem Kubanern) - trotzdem ist man in Washington bereit, soviel Geld für die Verteidigung auszugeben wie niemals zuvor.
Bei Jimmy Carter beklagte man in den letzten vier Jahren in den europäischen Hauptstädten dessen Führungsschwäche und nahm sie zum Anlaß für weltpolitische Alleingänge. RonaldRea-gan will wieder Flagge zeigen, was die NATO-Alliierten bereits begrüßten.
Was aber, wenn der kommende Präsident die NATO-Verbündeten wieder in einer geschlossenen Reihe hinter den USA versammelt haben will? Es läßt sich allzu leicht voraussehen, daß es alsbald wieder europäische Klagen über die amerikanische Bevormundung geben wird ...
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!