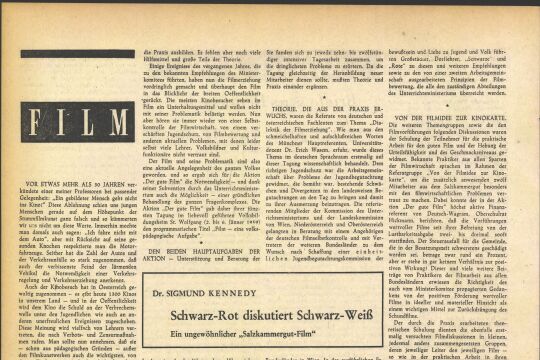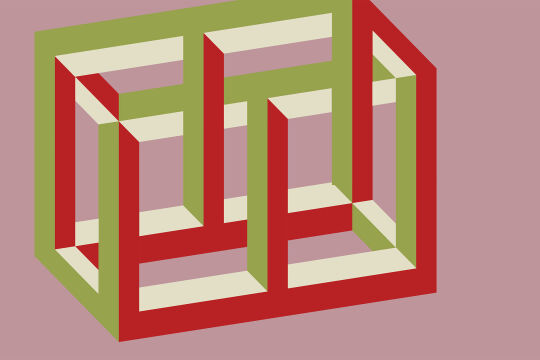Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Wie gesund ist Herr Österreicher?
Krankenschwestern sind imstande, innerhalb gewisser Grenzen die Tätigkeiten eines Arztes in der täglichen Praxis zu erfüllen. In einem Versuch in der kanadischen Stadt Burüngton erhielten zwei Krankenschwestern auf Initiative der Ärzte und mit Förderung durch öffentüche Stellen eine zusätzliche medizinische Ausbildung an der Universität.
Danach konnten sie ein Drittel aüer Patienten, die in die Praxis kamen, eigenständig behandeln, diagnostizieren wie auch therapieren. Diese Patienten wurden den Schwestern nach dem Zufallsprinzip zugeteüt, steüen also einen repräsentativen Querschnitt durch die Klientel eines praktischen Arztes dar.
In der kontrolüerten Nachuntersuchung durch unabhängige Fachleute (Ärzte), die nicht wußten, welche der Patienten von den Medizinern und welche von den Hilfskräften behandelt worden waren, zeigte sich, daß sowohl Ärzte als auch Schwestern jeweüs zwei Drittel der Kranken adäquat behandelt hatten. 70 Prozent der Rezepte erwiesen sich als angemessen - so zumindest die Ansicht der akademischen Prüfer. Auch die Patienten selbst waren mit der medizinischen Betreuung durch die Schwestern zufrieden.
Diese Studie und ihr Ergebnis sind symptomatisch für die Botschaft einer wissenschaftlichen Arbeit, die nun in Buchform erschienen ist, nachdem sie jahrelang nur hektogra-phiert vorgelegen ist und dementsprechend unzugänglich war: Die „Systemanalyse des Gesundheitswesens in Österreich“ in zwei Bänden, erstellt von einem Team aus 28 Wissenschaftlern im Auftrag des Bundeskanzleramtes.
Die Studie bietet eine Überfülle von Grundlagenmaterial zur Frage: Was ist schlecht an unserem Gesundheitswesen und wie könnte man es besser machen?
Eine Reihe von Zitaten zielt auf einen gemeinsamen Schluß: WU1 man das Gesundheitswesen verbessern und an die Steüe eines „medizinischen Modells von Krankheit“ ein „gesundheitspoütisches Modeü von Gesundheit“ setzen, wird man neue Strukturen suchen und durchsetzen müssen: zum Beispiel die Delegierung vieler Aufgaben, die heute exklusiv nur dem Ärztestand vorbehalten sind, an „paraprofessioneüe Kräfte“, wie Krankenschwestern, spezieü ausgebüdete Sozialarbeiter und dergleichen.
Die Pubükation der Studie, die schon vor fünf Jahren größtes Aufsehen in Österreich erzielt und ausgelöst hat, weü sie teüweise als Grundlage für den Fernsehfilm „Krank -Anmerkungen zum Spitalswesen“ gedient hat, besitzt gegenüber den bisher vorüegenden hektographier-ten Bänden einen Vorteil: sie ist nicht nur in vielen Teüen neu durchredigiert und auf den letzten Stand gebracht worden, sondern sie kann auch bereits einen großen Teü der Reaktionen widerspiegeln, die sie in der öffentiichkeit (durch den „Krank-Report“, aber auch durch teüweise Vorabdrucke in Tageszeitungen) seinerzeit ausgelöst hat.
Die Autoren formuheren das so: „Schon nach Veröffentüchung der zahlenmäßig sehr beschränkten ersten Auflage sind die wesentüchen Reaktionsformen der mit dem Gesundheitswesen befaßten Akteure erkennbar und in großen Zügen voraussehbar geworden. Große Teüe der organisierten Ärzteschaft und der betroffenen Kapitalfraktionen werden in ihrer Kritik am Sprachstü und an
Detaüproblemen ansetzen, die wichtigsten Aussagen des Berichts als Produkt ideologischer Verirrungen oder utopischer Schwärmereien ab-quaüfizieren und die Untersuchung genereü als Versuch der .Systemän-derung zu diskreditieren versuchen. Eine derartige Kritik wird begleitet sein von Disziplinierungsversuchen gegenüber einzelnen Projektmitgliedern - Bestrebungen, die sich schon im Projektverlauf gezeigt haben.“
Und weiter mutmaßen die Verfasser: „Vom wissenschafthchen Estab-üshment sind insbesondere zwei Reaktionsformen zu erwarten: Zum einen wird der systemanalytische Ansatz in seiner inhaltüchen Ausrichtung als .linke Ideologie' zu disqualifizieren versucht werden. Zum anderen wird die Kritik konkretistisch an einzelnen Hypothesen ansetzen, vereinzelte entgegengesetzte empirische Evidenz entgegenhalten und andersartige Interpretationen vorbringen, um zentrale Gesamtaussagen des Projektes, die dem vorherrschenden
Problemverständnis zuwiderlaufen, zu .widerlegen'.“
Recht geschickt, dieser Ausbhck auf zu erwartende Reaktionen. Wer Argumente des Gegenübers vorwegnimmt, zwingt dieses, seine Argumente entweder neu zu formuheren oder zumindest zu differenzieren, sollen sie nicht als „alte Hüte“ wirken.
In dieser Formulierung ihrer Ver-teidigungssteüung gegenüber den „Stützen der Geseüschaft“ charakterisieren die Autoren der Studie aüer-dings gleichzeitig ihr eigenes Produkt. Wer die zitierte Verteidigungsrede liest, weiß, was ihn erwartet, wenn er sich durch die mehr als 1000 Seiten der „Systemanalyse“ durcharbeitet:
• Am Sprachstü läßt sich Kritik üben, was übrigens die Autoren selbst offen zugeben. Sie schreiben, daß ein großer Teü des Berichts „in einer akademischen Sprache abgefaßt“ wurde, die „einem breiten Diskussionsprozeß nicht förderiich“ ist.
• Viele der getroffenen Aussagen muß man selbst - eigentüch gerade -bei distanzierter, um Objektivität bemühter Betrachtungssweise als „ideologisch“ und „utopisch“ bezeichnen.
•„Systemänderung“ ist ganz eindeutig das Ziel der Planvorsteüun-gen, die in der Studie zum Ausdruck kommen. Es soü das derzeit gültige System geändert werden, und zwar nicht durch eine .Reform von oben“, sondern durch Maßnahmen, die von unten her kommen. Konkret: Man wül in besonderem Maß den Gewerkschaftsbund dafür interessieren, sich der Anliegen der Reformer anzunehmen. Das geht Hand in Hand mit der Uberzeugung, daß die Arbeitsbedingungen der Hauptfaktor bei der Entstehung von Krankheiten sind.
• Die - nicht in aüen, aber in vielen Beiträgen - zum Ausdruck kommende Grundhaltung ist zweifeüos flinke Ideologie“. Kaum wird auf die Frage eingegangen, wie Krankheit in „nichtkapitaüstischen Ländern“ entsteht, ob es nicht auch Faktoren geben könnte, die über die schematische Einteüung in „kapitalistisch -nichtkapitaüstisch“ hinausgehen.
Das heißt also: Wer sich die „Systemanalyse des Gesundheitswesens in Österreich“ vornimmt, muß damit rechnen, daß er sich durch teüweise nur auf den zweiten oder sogar dritten Bück verständüche Formuhe-rungen durchkämpfen muß und daß er auf Schritt und Tritt mit der Fest-steüung konfrontiert werden wird, daß wir in einem „kapitähstischen“ System leben, welches von sich aus nur zu Reformen mit marginaler Wirkung fähig ist.
Bei aü diesen Einschränkungen muß dennoch gesagt werden, daß das Buch für jeden, der sich mit Fragen des Gesundheitswesens auseinandersetzt, unentbehrlich sein dürfte -wobei diese Fragen weit reichen, bis in die Bereiche des Umweltschutzes, der Energiesituation und der Problematik unserer heutigen Landwirtschaft.
So wird konkret angeführt, was man über die Tatsache weiß, daß Arbeiter schwerere und mehr Krankheiten als Angestellte haben; daß Bauersfrauen in Österreich zwischen dem 20. und dem 40. Lebensjahr ein um das Zehnfache erhöhtes Todesrisiko haben gegenüber dem Durchschnitt aller Frauen dieser Altersgruppe. Man erfährt, daß der Herzinfarkt keineswegs die typische „Managerkrankheit“ ist, als die er immer wieder hingestellt wird: Das höchste Herzinfarktrisiko hat die unterste Schicht der Angestellten, erst dann folgen die Manager, und zuletzt kommen die mittleren bis höheren Schichten der Angestellten.
Es wird belegt festgestellt, daß der steigenden Lebenserwartung und dem Rückgang von Infektionskrankheiten als Plus der modernen Industriegesellschaften ein Minus in Form überproportionaler Zunahme von sechs Krankheitsgruppen gegenübersteht: Herz-Kreislauferkrankungen, Tumore, Krankheiten der oberen Luftwege, Unfälle, psychische Störungen und iatrogene Erkrankungen.
Mit „iatrogenen Erkrankungen“ sind Störungen gemeint, die erst durch die Intervention des Arztes entstehen: Nebenwirkungen von Medikamenten zum Beispiel.
Eines der zentralen Themen, auf die man immer wieder zurückkommt, ist der Arbeitsplatz. „Die Arbeitsbedingungen machen krank“, lautet die Grundhypothese. Als Belege werden Studien genannt wie eine Untersuchung in den USA, die gezeigt hat, daß nur 25 Prozent aller Herz-Kreislauferkrankungen durch das Vorhandensein von Risikofaktoren erklärbar sind. 75 Prozent gehen auf Unzufriedenheit mit dem Arbeitsplatz und seinen Bedingungen zurück. Generelle Arbeitszufriedenheit und Glücksgefühl seien die Hauptfaktoren für ein langes, gesundes Leben.
So ist diese Studie des österreichischen Gesundheitswesens eine Arbeit, die weit über die Grenzen Österreichs hinauseilt.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!