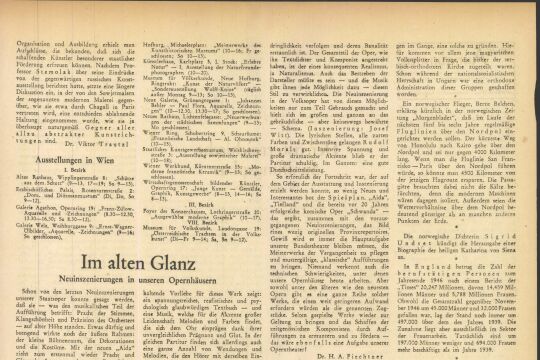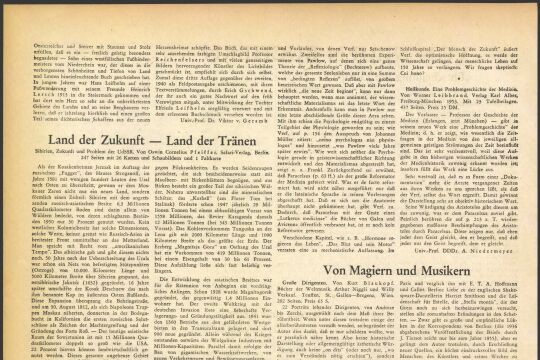Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Wie's im Büchel steht
Am vergangenen Sonntagabend gab es in der Staatsoper die Premiere von Webers „Freischütz“ unter der Leitung von Doktor Karl Böhm, inszeniert von Otto Schenk, mit Bühnenbildern von Günther Schneider-Siemssen und Kostümen von Leo Bei. Seit dem Juni 1944 ist diese Oper nicht mehr im Großen Haus am Ring gespielt worden. „Der Freischütz“, am 18. Juni 1821 in Berlin mit sensationellem Erfolg uraufgeführt und als nationales Ereignis (am sechsten Jahrestag von Belle Alliance) gefeiert, ist die zweite Oper, die der junge Karl Böhm dirigiert hat. Otto Schenk inszenierte sie zum erstenmal, und der scheidende Operndirektor Reif-Gintl hatte sie sich als letzte Premiere seiner Ära gewünscht. Diese Aufführung, das sei voraus-gecshickt, wurde für alle Beteiligten ein voller Erfolg.
Am vergangenen Sonntagabend gab es in der Staatsoper die Premiere von Webers „Freischütz“ unter der Leitung von Doktor Karl Böhm, inszeniert von Otto Schenk, mit Bühnenbildern von Günther Schneider-Siemssen und Kostümen von Leo Bei. Seit dem Juni 1944 ist diese Oper nicht mehr im Großen Haus am Ring gespielt worden. „Der Freischütz“, am 18. Juni 1821 in Berlin mit sensationellem Erfolg uraufgeführt und als nationales Ereignis (am sechsten Jahrestag von Belle Alliance) gefeiert, ist die zweite Oper, die der junge Karl Böhm dirigiert hat. Otto Schenk inszenierte sie zum erstenmal, und der scheidende Operndirektor Reif-Gintl hatte sie sich als letzte Premiere seiner Ära gewünscht. Diese Aufführung, das sei voraus-gecshickt, wurde für alle Beteiligten ein voller Erfolg.
Wenn von Carl Maria von Weber die Rede ist, wird stets auch vom „Deutschtum“ seiner Musik gesprochen. „Nie hat ein deutscherer Musiker gelebt als du“, rief ihm Wagner während der Beisetzung in Dresden nach, und als „Befreier der deutschen Oper von der Fremdherrschaft“ feierte ihn ein nationalgesinnter Musikhistoriker, der von Weber ferner sagte, er gehöre „für immer zum freiherrlichen Schwertadel der deutschen Musik“. Weber selbst, alemannischer Abstammung mit einem französischen Großvater unter seinen Vorfahren, im nördlichen Eutin geboren, mit einem hochstaplerisch-phantastischen Vater belastet, der sowohl die adelige Herkunft wie den österreichischen Stammbaum frei erfand, hat in seinem bewegten Leben einen großen Teil Europas kennengelernt. Er studierte unter anderem bei Michael Haydn, war Leiter der Dresdner Hofoper und des Prager Ständetheaters und ist während einer Konzertreise, die seine finanzielle Misere beseitigen sollte, in London gestorben. Weber wollte tatsächlich eine andere Art von Oper, als sie bisher bekannt und beliebt war, „ein in sich abgeschlossenes Kunstwerk, wo alle Teile und Beiträge der verwandten Künste inein-anderschmelzend verschwinden und, auf gewisse Weise untergehend, ein neues Werk bilden“. Es ist, als ob man Wagner reden hörte. Und doch ist aus dieser so ähnlichen Theorie etwas ganz anderes entstanden, nämlich „Der Freischütz“.
Drei volle Jahre hat der sonst so flott schreibende Weber an dieser Partitur gearbeitet. Johann Friedrich Kind hat ihm innerhalb kürzester Frist ein im einzelnen anspruchsloses, im ganzen aber sehr wirkungsvolles Textbuch geliefert, dessen Entstehungsgeschichte reichlich kompliziert war. Die Handlung ist bekannt, die Qualitäten von Webers Musik ebenfalls. Hector Berlioz hat das Werk kongenial gewürdigt. Das mag man im Programmheft der Staatsoper nachlesen („Itelligenz, Phantasie, Genie strahlen von allen Seiten mit einem so starken Glanz, daß nur Adleraugen ihn ohne Ermüdung ertragen könnten ...“)
Karl Böhm, dem Werk seit seiner Jugend zutiefst verbunden, hat alle
Kostbarkeiten dieser Partitur mit Hilfe der Philharmoniker in hellstes Licht gerückt. Auch das Düster-Dämonische blieb klanglich transparent. — Otto Schenk hielt sich streng an die Wünsche des Komponisten und machte gar nicht erst den Versuch, ins Allegorisch-Symbolische auszuweichen oder „modern“ zu stilisieren. Er nahm diese romantische Geschichte — mit Liebe, Teufelsspuk, deutschem Wald und Försterhaus, tödlicher Bedrohung und wunderbarer Rettung — gewissermaßen „au pied de la lettre“, und wir meinen, daß er gut daran getan hat. Denn man kann diesen „Freischütz“ nur so wie er ist, in seiner ursprünglichen Gestalt und Absicht, akzeptieren — oder als veraltet ablehnen.
In Übereinstimmung mit dem Regisseur hat Schneider-Siemssen eine snnisaspn realistische Romantik auf die Bühne gestellt: mit „echten“ herbstlichen Bäumen und mehr als hundert von Leo Bei folkloristiseh gekleideten Personen, die gleich nach Aufgehen des Vorhangs Sonderapplaus erhielten. Auch die einzelnen Gestalten hat er realistisch durchgezeichnet und nirgends diesen Rahmen verlassen. Natürlich fehlte es auch in der Wolfsschlucht weder an Blitz und Donner noch an Teufelsqualm und allerlei grauslichem Zubehör.
Die durchweg vorzüglichen Sänger fügten sich diesem Konzept — so schien es wenigstens — ohne Widerstreben, ja mit Vergügen. Gundula Janowitz wurde als Agathe nach je-jeder ihrer großen Arien lebhaft gefeiert, Renate Holm verstand es, die heikle Rolle des Ännchen, die leicht ins Possierliche abgleitet, mit Anmut und Humor auszustatten, James King war ein sympathischer, schön singender Max, Karl Ridder-busch mehr stimmlich als in der Erscheinung jener Teufelsbraten, als den ihn uns J. F. Kind vorführt, Manfred Jungwirth, ein väterlich besorgter Erbförster, Eberhard Wächter ein würdiger Fürst. —r Techniker und Beleuchter taten ihr Bestes, in Übereinstimmung mit jenen Worten aus Webers letztem Lebensjahr, durch die er einem jüngeren Kunstgenossen das Geheimnis des dramatischen Komponisten verraten hatte: „Penetranz, die überdeutliche Charakterisierung, den Mangel an Zurückhaltung ...“
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!