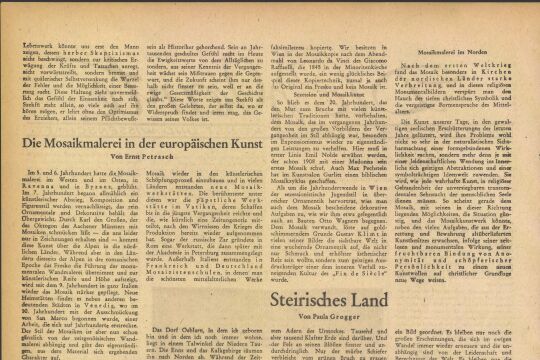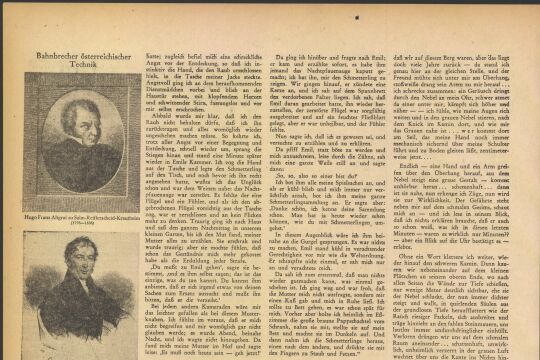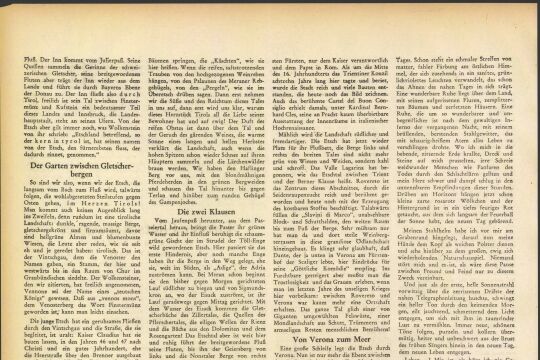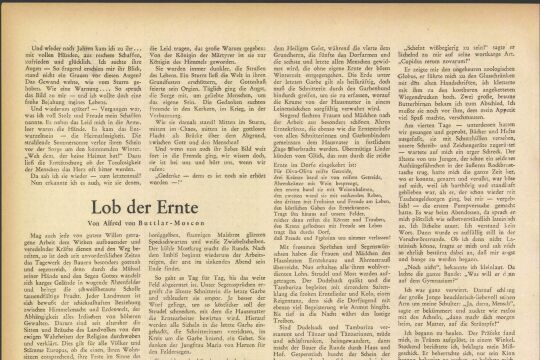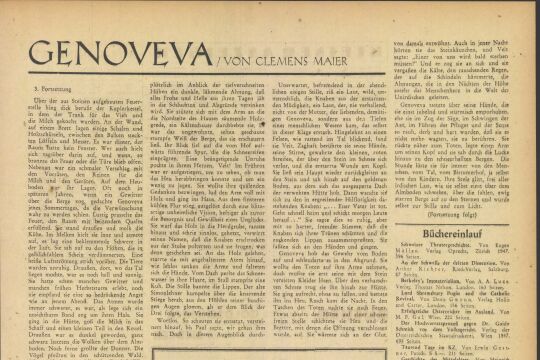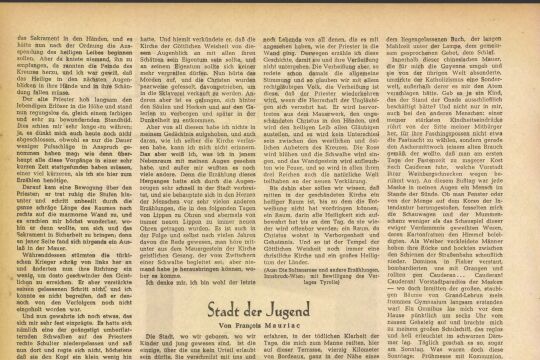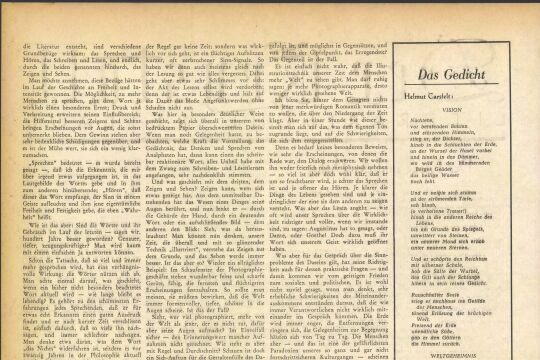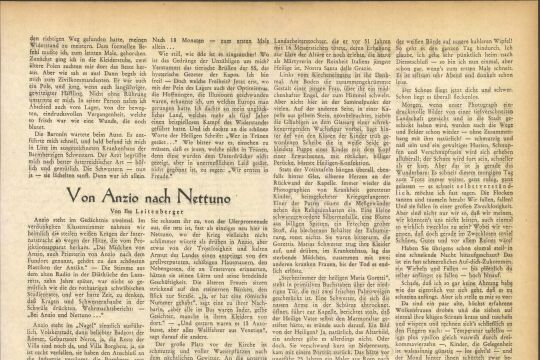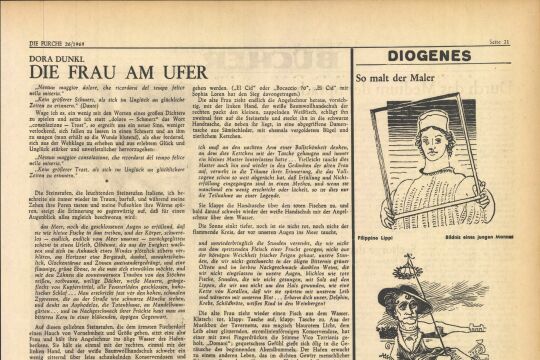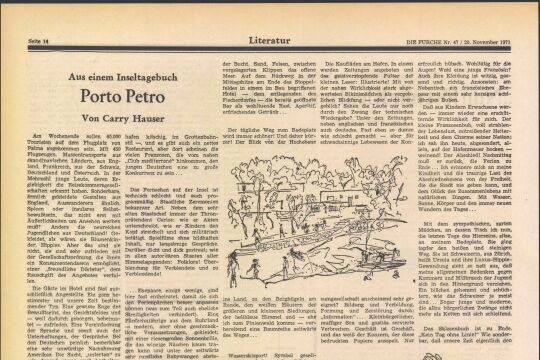Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Winterbild mit Krähen
Es gibt nur noch wenige richtig kalte Tage im Jahr, Tage, an denen man merkt, was Winter ist: heute eine beinahe verlorengegangene oder doch eine entkräftete Jahreszeit. Erster Schnee fällt jetzt anders als in dem Gedicht Leopold von Goeckingks. Das Naturereignis bleibt aus. „Der Schneefällt leise. Schläfst du, süße Freundin?“ hat so wenig überlebt wie das zarte Gedicht Walter Hasenclevers.
Ich denke an einige norddeutsche und ostdeutsche Winter. An die große, lang anhaltende Kälte vor bald vierzig Jahren, als ich Schuljunge war. Morgens auf den dunklen, eisigen Straßen — wenn wir unterwegs zum Gymnasium waren — begannen die Ohrmuscheln anzufrieren. Der gefährliche Wind fauchte und wirbelte winzige Eiskristalle. Man fror hinter den Augen. Es gab keine Farben mehr. Alles war weiß: eine Begrüßung, ein Abschied, ein gesprochener Satz, der Atem vorm Mund. Nur diese eine Farbe, die keine Farbe war. Es war ein Lebenmit weißer Lunge.
An jedem Nachmittag überzog ein Dschungel Eisblumen die Fenster für die kommende Nacht, in der hinter den Häuserfronten ein weißer Mond aufkam. Draußen stolperten Schritte von Pas- • santen vorüber. Das klang wie Scheibenklirren, während das frühe Dunkel aufs kalte Relief der Landschaft sank. Der übertriebene Winter ist in der Erinnerung ohne Nüchternheit. Es ist der phantastische Winter der in den Taschen erstarrten Hände, der kalten Lähmung, die vom Körper Besitz ergreift. Der unglaubwürdige Winter der winzigen Geschehnisse, die sich nicht schildern lassen und nachträglich sogleich ein Übermaß an Bedeutung annehmen, die das Maß des Erinnerungsvermögens nicht fassen kann.
Ich finde mich in Betrachtung einzelner pastorenschwarzer Krähen, die aussehen, als ob sie aus einem japanischen Holzschnitt aufsteigen. Eine Winterlandschaft ist keine Landschaft des epithėte rare, das für die
Brüder Goncourt die Kennmarke des Schriftstellers war. Vielmehr atmet man in ihr — um eine Bemerkung Flauberts abzuwandeln — das Leben in einfachen Sätzen, in Aussage-Sätzen. Schnee macht einsilbig. Es ist die Wortkargheit der weißen Fläche, die mit den wenigen Linien eines geometri-sierten Landes fürliebnimmt. Die blätterlosen Bäume ragen höher in den Himmel als die belaubten. Die winterliche Durchsichtigkeit ist anders als die herbstliche. Man erfährt sie angesichts eines Kohlenfeuers, über dem die Straßenluft aufzuleben scheint, oder in der Märchenerscheinung einer Dame in Weiß am Fenster, hinter dem jemand - im Inneren des Zimmers — mit einer Lampe lauert. Ein stilles Bild, denn es ist keine Zeit für Ovationen. So lautlos als Ereignis wie eine den fallenden Schnee fangende Katze, die den Flocken wie Singvögeln nachstellt.
Die stilistischen Abenteuer der anderen Jahreszeiten haben hier nichts mehr zu suchen. Die Zeitwörter werden sparsam verwendet. Die Eigenschaftswörter müssen sich eine ähnliche Behandlung gefallen lassen. Man kommt auf das zurück, was übriggeblieben ist. Man behilft sich mit ihm.
Ökonomie der Kälte: es gilt, Kräfte zu sparen. Das Horn der Nägel wächst langsamer. Die Wärme einer Hand bietet genügend Leben. Für eine Weile hält man diese fremde Hand in der seinen. Der Augenblick vergeht als weiße Wimper.
Ich erinnere mich an das un-term Januar schnee begrabene Oslo mit seinen spiegelglatten, verharschten Trottoirs. Skiläufer kamen noch spätabends vom Hol-menkollen zurück und schwärmten über die illuminierte Karl Johans Gate. Gebirgswinter war in die Hauptstadt gekommen. Überall an den Hauswänden lehnten als Warnung vor den vereisten Dächern eiserne Stangen. Zum Abendessen Schneehuhn mit Preiselbeeren. Vorm Schloß hielten Zinnsoldaten Wache. Andersens Märchen wurden einige hundert Kilometer weiter südlich geschrieben.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!