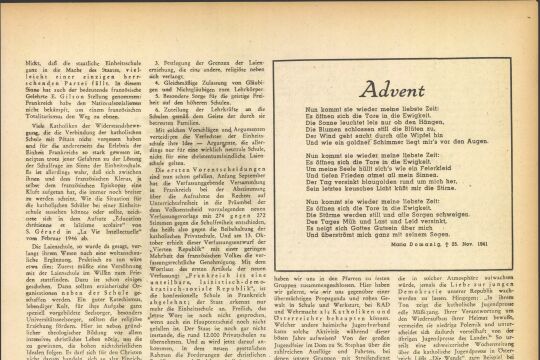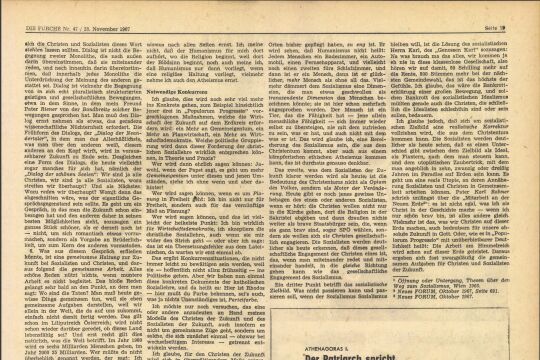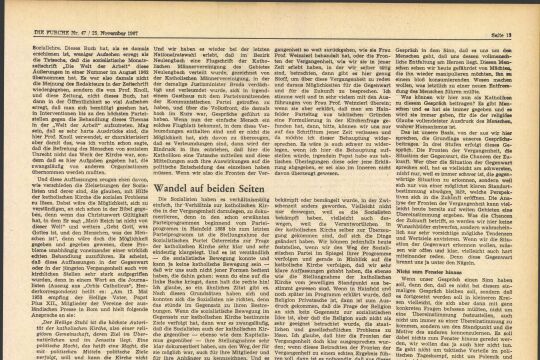Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
WO GEHÖRE ICH HIN?
Es gibt aber noch ein anderes Problem, eine andere Fragestellung, die wir nicht unberücksichtigt lassen dürfen. Und das sind gesamtgesellschaftliche Entwicklungen, die überhaupt nichts mit den Migrationslragen zu tun haben: Jürgen Habermas hat von der neuen Unüberschaubarkeit gesprochen. Das heißt, die Menschen, in einer bestimmten Region, in einer Stadt, in einem Stadtteil, werden auch konfrontiert mit einer so offenen Welt, die praktisch nicht mehr erfaßbar ist. Was ist Heimat? Wo gehöre ich hin? Wo sind die Grenzen'.' Die Dimensionen haben sich verändert. Wir sind in vierzehn, fünfzehn Stunden in Tokio. Wir bekommen Nachrichten aus aller Welt. Das heißt, es ist sehr schwer Identität zu entwickeln und es ist deswegen sehr leicht und sehr notwendig, auch Gründe zu suchen für den Unmut, der sich damit entwickelt. Dazu braucht es sehr häufig „Sündenböcke".
Das heißt, bei allem was wir tun, spielen diese gesellschaftspolitischen Entwicklungen und Prozesse eine sehr wichtige Rolle. Die Migrantinnen und Migranten sind im Grunde nur sichtbare Exponenten dieser Entwicklung. Die ganze Sache hat scheinbar etwas mit „Ausland" zu tun. Ein Ausländer odereine Ausländerin ist die Inkamation dieser Geschichte. Bei Diskussionen in Stadtteilen spürt man, was der Unmut, eigentlichdie Angst, heißt: ..Ich weiß nicht mehr, wo das anfing. Ich weiß nicht mehr, wo ich hier hingehöre. Was ist denn noch hier für mich verbindlich, was ist hier noch mein Zuhause, wenn da ständig alles irgendwie nicht mehr greifbar und fest ist?"
Der Konflikt zwischen Modernität und Tradition macht sich da auch fest. Es ist sehr wichtig, bei allen Überlegungen nicht zu vergessen, daß es nicht nur um technische Fragen der Regulierung von Wanderung, Arbeitsmarkt, Wohnungsbau, Beratung und Bildung geht. Es geht viel, viel weiter. Und es betrifft uns. Kann man sich eigentlich mit einer Verwaltungsbehörde in diesen Prozeß einschalten? Das kann man kritisch fragen, frage ich mich auch immer wieder. Kann ich das überhaupt? Kann ich den Auftrag, den wir haben, überhaupt erfüllen? Das setzt voraus, daß meine Vorgesetzten mirerlauben, mir auch öffentlich über diese Prozesse Gedanken zu machen. Das ist nicht üblich für die Verwaltung. Verwaltung hat nur zu handeln, darf eigentlich nicht philosophieren. Das setzt, aber voraus, daß man darüber reden können muß, und es setzt voraus, daß möglichst viel Handlungsspielräume da sind. •
Wir haben gesagt, die Ausländerinnen und Ausländer in einer Stadtgesellschaft sind keine autochthone Gruppe, sie sind auch keine homogene Gruppe. Wir haben in Frankfurt 3.000 Japanerinnen und Japaner, denen geht es sehr gut, die tauchen in keiner Form mit Problemen auf, es sei denn, sie finden keine Wohnung. Gleiches gilt für den gesamten Bereich der „Yuppies". Sie kennen vielleicht aus den Medien die momentane Diskussion in der Frankfurter SPD. da setzt man sich damit genau auseinander. Wer ist unsere künftige Zielgruppe? Sind es die Angestellten in den Fluggesellschaften, in den Banken? Sind das, auch SPD/SPÖ-Wäh-ler und Wählerinnen oder haben wir mit denen nichts zu tun? Wir müssen uns auf die Arbeiterklasse konzentrieren! Wer ist denn das noch?
Die Ausländerinnen und Ausländer dürfen gar nicht wählen. Eine sehr interessante Diskussion zwischen den unterschiedlichen Kräften und man sieht sehr deutlich, daß sich hier etwas entwickelt hat. Frankfurt ist ja eine Dienslleistungsstadt mit sehr hohem Strukturwandel: Es gehen immer mehr Betriebe raus, und es kommen immer mehr Büros rein. Die Frage ist: Die Ausländerinnen und Ausländer, die da leben und da arbeiten in diesen Büros, sind die auch unsere Zielgruppe?
Wir haben gesagt: die Zielgruppe für die Arbeit unseres Amtes ist die gesamte Frankfurter Stadtbevölkerung. Wir bilden keine Lobby für die Ausländerinnen und Ausländer, sondern alle sind einzubeziehen in Überlegungen, wenn wir irgendetwas tun. Alle, es gibt keine Unterscheidung. Aber ■unserZiel ist. die Herstellung von Partizipa-tionsmög Henkelten und von Gleichberechtigung, soweit das auf kommunaler Ebene möglich ist.
Wie in Österreich auch sind wir natürlich von Bundesgesetzen abhängig und können in der Stadt nicht alles tun, was wir gerne tun würden. Dazu gehörte auch der Abbau von Verarmungsrisiko. Daran sehen Sie schon: es geht nicht nur um die Kranken. Es geht um die Schaffung von Freiräumen, sowohl für die soziale wie auch die kulturelle Entfaltung. Es geht aber auch um die Stärkung der Autonomie und der Selbsthilfe, also nicht um die ständige Betreuung und Gänge-lung und Bevormundung, nicht um den Paternalismus, der ja auch in dem Bereich der Helfer sehr stark, ist. Wir sprechen in Frankfurt auch von Integration, sagen aber immer dazu: Wir meinen nicht Assimilation! Für uns ist Integration kein Gegensatz zu einer eigenständigen Entwicklung. Integration ist eine recht-liche und soziale Gleichstellung und Partizipationsmöglichkeit.
Wie ich zu Hause mein Osterfest feiere, meine Kinder taufe, wie ich mich kleide, was ich in meiner Freizeit tue, das ist damit nicht gemeint. Wir meinen aber auch, daß wir darauf hinarbeiten müssen, daß die Rechtsnormen, die in dem Aufnahmeland (in dem Land, in dem man lebt) herrschen, akzeptiert werden. Wie das zu erfolgen hat. wie man zu der Akzeptanz der vorhandenen Rechtsnormen beitragen kann, das ist eine andere Frage. Wir möchten nicht, daß zum Beispiel islamisches Recht in Frankfurt angewandt wird. Die Menschenrechte beispielsweise könnte man als Normengefüge darübersetzen und sagen: „Da wollen wir uns alle dran halten. Da wollen wirnicht mehrdahinterzurück!" Auch dann nicht, wenn wir kulturelle Wertvorstellungen und Normen von anderen Menschen und Kulturen akzeptieren möchten.
Die Autorin ist Leiterin des Amtes für multi-kulturelle Angelegenheiten in Frankfurt/M: der Text ist ein Auszug aus ihrem Referat bei der Siudientagung „Hallo Nachbar!" des Dr. Karl-Renner-Instituts Wien am 19. April 1991.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!