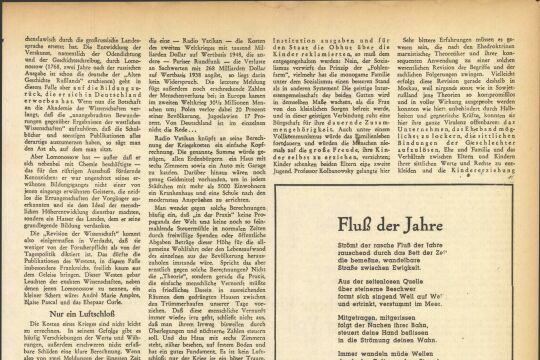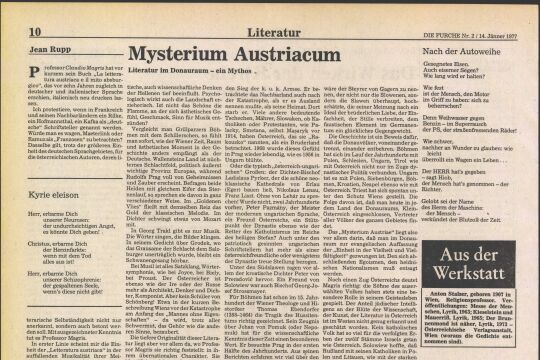Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
„Women's studies“ als politische Aktion
Dem noch immer weit verbreiteten Vorurteil, daß die „Frauenfrage“ das Problem von ein paar individuell frustrierten „Emanzen“ sei, wurde bei einem Frauenkongreß in Köln endgültig der Kehraus gemacht: Uber 1000 Frauen aller Altersstufen kamen zusammen, nicht nur um ihre Leiden, Ängste, Minderwertigkeits- und Beziehungskonflikte zu verbalisieren. Dies war vielmehr der Ansatzpunkt, um in harter Kopfarbeit Strategien für eine Veränderung zu entwickeln.
Was ist Frauenforschung?
Wenn Frauen anfangen, ihre Situation zu analysieren, dann hat das Rückwirkungen auf die Forschungen, die sich mit der gesellschaftlichen Position der Frau befassen. Das trifft insbesondere zu für das, was heute allgemein „women's studies“ (Frauenforschung) genannt wird.
„Women's studies“ bezeichnet nicht einfach die Tatsache, daß die Zielgruppe Eingang in den akademischen Forschungsbetrieb gefunden hat, sondern bedeutet, daß sich engagierte Frauen im Hochschulbereich mit der gesellschaftlichen Unterdrückung der Frauen insgesamt so beschäftigen, daß sie auf eine Aufhebung dieser Unterdrückung hinwirken. Dabei sind sie sowohl Betroffene, die die Unterdrückung in irgendeiner Weise selbst erfahren haben, als auch Forschende, die sich wissenschaftlich mit dieser Unterdrückung und den Möglichkeiten ihrer Aufhebung befassen.
Die bisherige Forschung über Frauen, die sich auf lineare Aussagen über unterschiedliche Repräsentanzen von Frauen in verschiedenen Berufszweigen, politischen Gremien oder Bildungsinstitutionen beschränkte, hat die Situation der Betroffenen meist nicht verändert. Das bedeutet, daß die herkömmlichen wissenschaftlichen Methoden einer engagierten Frauenforschung nicht gerecht werden können.
Zu den Postulaten der Frauenforschung gehört einerseits die Uberwindung der hierarchischen Strukturen von „Experten“ und „Laien“ und anderseits die Aufhebung der Trennung von „Forschung“ und „Praxis“.
Die „Wertfreiheit“, die die traditionelle Wissenschaft wie ein Heiligenschein umgibt - oft um ihre eigentlichen Ziele dahinter zu verstecken -wird durch bewußte Parteilichkeit ersetzt; das heißt, die Forscherin ist nicht „objektive, interessierte Beobachterin“ (wie etwa Helge Pross bei einer Untersuchung über Hausfrauen), sondern sie läßt sich ein in die Probleme der Betroffenen, die ja meist auch ihre eigenen sind. Die Frauenforschung geht davon aus, daß Frauen die Expertinnen ihrer Lebenssituationen sind und ihre Erfahrungen die eigentlichen Wissenschaftsqualifikation für die Wissenschaftsarbeit darstellen.
Eine Gruppe von Psychologinnen in Hannover praktiziert bereits sinnvolle Frauenforschung: Sie hat 30 Industriearbeiterinnen, alle verheiratet und Mütter, einerseits und 30 Hausfrauen mit Kindern, die ihren Beruf aufgegeben haben, anderseits befragt. Es handelte sich dabei um „qualitative Interviews“, das heißt um drei Gespräche mit jeder Frau, die jeweils zwischen zwei bis vier Stunden dauerten. Dabei kamen -zum Beispiel bei den Fragen um die Hausarbeit - sehr stark die Widersprüche zwischen Meinungsklischees („lieber Hausarbeit als Beruf) und persönlichen Erfahrungen („doch lieber Beruf) zum Vorschein. (Die quantifizierende empirische Sozialforschung kann solche Widersprüchlichkeiten nicht sichtbar machen.)
In dem Projekt, das noch nicht abgeschlossen ist, zeichnen sich (nach 18.000 Seiten Protokoll) bereits eindeutige Tendenzen ab: Bei den „Nur-Hausfrauen“ steht das Problem der Isolation im Vordergrund, das sich oft auch in physischen Leiden, wie Müdigkeit und Kopfschmerzen ausdrückt. Die Hausfrauen, die gleichzeitig in der Fabrik arbeiten, klagen zwar über die Uberbelastung, möchten aber ihren Beruf nicht aufgeben, weil sie dabei „Kontakte, Selbstbestätigung und finanzielle Unabhängigkeit“ gewinnen.
Sobald die Studie ausgewertet ist, soll sie der Betriebsrat und auch die Frauen selbst in die Hand bekommen - das heißt, die Psychologinnen bedienen sich bei ihrer universitären Arbeit nicht nur einer außergewöhnlichen Verfahrensweise, sondern sie stellen sie auch einem „üblichen“ Verwendungszweck zur Verfügung.
Derartige wissenschaftliche Untersuchungen wollen also nicht nur neue oder interessante Ergebnisse liefern, sie sollen vielmehr den betroffenen Frauen eine Hilfestellung bieten, um ihre Situation zu überdenken, zu vergleichen und zu verbessern.
Im Vorjahr startete die deutsche Familienministerin Antje Huber die Aktion „Frauen können mehr“: Frauen, die zu Hause nicht ausgelastet sind und sich einsam fühlen, sollten sich für unentgeltliche karitative Tätigkeiten zur Verfügung stellen. Damit wurde zwar die Unzufriedenheit der Hausfrauen öffentlich bestätigt, gleichzeitig wurde aber „ das Gefühl einer vagen Unausgeglichenheit, Langeweile“ (Zitat aus der Broschüre des Familienministeriums zu der Aktion) für die eigenen Interessen mobilisiert:
Was die Frauenbewegung nicht will
Die Frauen sollen außer Haus fortsetzen, was sie bereits als Ehefrau und Mutter tun, unbezahlte Reproduktionsarbeit für andere leisten. Sicher ist eine Frau, die auf diese Weise Selbstbestatigung und Anerkennung sucht, der Erhaltung des Status quo (Mann im Produktionsprozeß, Kleinfamilie als emotionales Refugium) dienlicher, als eine, die versucht, ihre Lage kritisch zu überdenken und sich mit Gleichgesinnten selbst zu organisieren.
Einfacher ist es sicher auch für die Frau, wenn sie bei den ihr zugeordneten sozialen Tätigkeiten bleibt, weil jedes Ausbrechen aus der Rolle heute meist noch mit Kampf - und damit auch mit Schmerz - verbunden ist. Nur, ob der kampflose Weg der ist, der auf Dauer auch zufriedener macht, das sei dahingestellt.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!