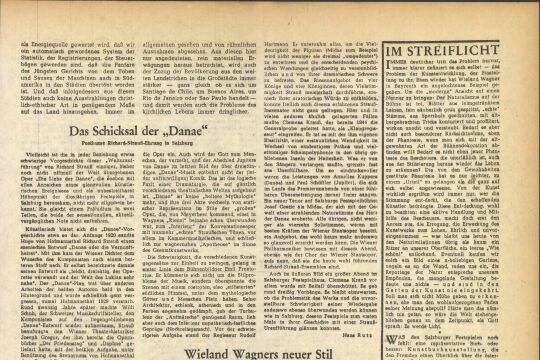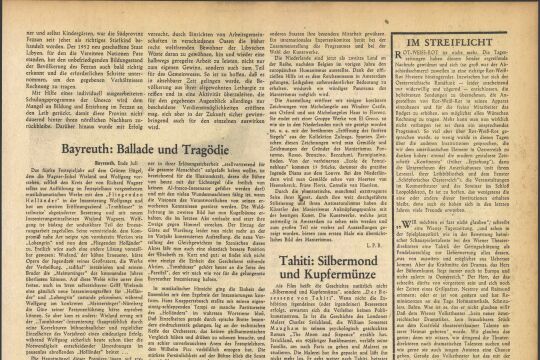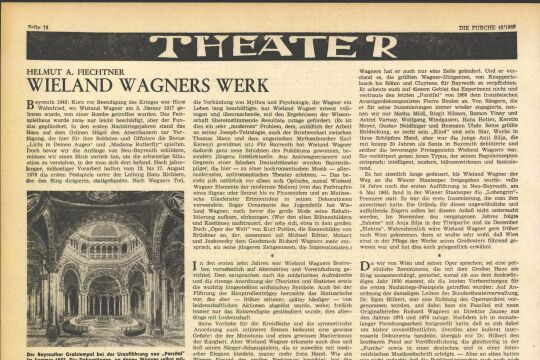Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Wunder und Wirklichkeit
In einem Vortrag in den dreißiger Jahren sagte einmal Emil Preetorius, seine Ausstattungen kommentierend, daß Wagners bildnerische Phantasie Visionen geschaffen habe, die nicht klar begrenzt,. optisch streng faßbar sind. Es handelt sich bei allen seinen Anweisungen weniger pm Konkretionen der künstle- HhMßW-Mute!. jmndjdr es ging Ifijn . yor allem um 4 « Wirkung, dre nzustreben is’t. KS ‘ han’deft siefr um "ÄÄVreMl(|ft Vines „Ohrenmenschen“, die aus der Welt des mit dem inneren Auge Erschauten nicht leicht ohne Schaden auf das konkret Sichtbare übertragbar sind.
In einem Vortrag in den dreißiger Jahren sagte einmal Emil Preetorius, seine Ausstattungen kommentierend, daß Wagners bildnerische Phantasie Visionen geschaffen habe, die nicht klar begrenzt,. optisch streng faßbar sind. Es handelt sich bei allen seinen Anweisungen weniger pm Konkretionen der künstle- HhMßW-Mute!. jmndjdr es ging Ifijn . yor allem um 4 « Wirkung, dre nzustreben is’t. KS ‘ han’deft siefr um "ÄÄVreMl(|ft Vines „Ohrenmenschen“, die aus der Welt des mit dem inneren Auge Erschauten nicht leicht ohne Schaden auf das konkret Sichtbare übertragbar sind.
Wagners theoretische und programmatische Erläuterungen zu Inhalt und Gestalt seiner Werke sind noch unklarer, zumindest vieldeutiger (wobei wir die These vom „Gesamtkunstwerk“ ganz beiseite lassen). Die romantische Oper „Lohengrin“, um die es hier geht, könne sein: ein Künstlerdrama; der Held selbst eine Wunschvorstellung Elsas, aber auch des Volkes, das den Retter ersehnt; metaphysisch betrachtet: die Erscheinung des Göttlichen unter Menschen; und schließlich eine Aktion vor sozialem Hintergrund, wobei Elsa das Volk, Ortrud aber die Reaktionärin repräsentiert, mit Wagners eigenen Worten: „Sie ist eine Reaktionärin, eine nur auf das Alte bedachte und allem Neuen Feindgesinnte, und zwar im wüthen- den Sinn des Wortes.“ Da ist also der Interpretation viel freier Spielraum gegeben, auch zu Gedanken spielen, zumal wenn Wagner erklärt, er sei sich über diesen seinen Lohengrin noch längst nicht im klaren: „Ich weiß, daß hier noch eine Masse wichtiger Beziehungen verborgen liegen.“
Bei dem Premierenabend am vergangenen Donnerstag in der Staatsoper wären ihm einige solcher „Beziehungen“ durch die Herren Joachim Herz (dem Leipziger Opemchef) und Rudolf Heinrich, den von ihm bevorzugten Bühnenbildner, vor Augen geführt worden. Und zwar gleich nachdem sich der Vorhang zum erstenmal hob: da stand, statt der sächsischen, thüringischen und brabantischen Grafen und Edelleute, statt der Mannen, Frauen und Ritter, ein ungegliederter Volkshaufen in Elendskostümen, Grau in Grau, wie aus der englischen Bettleroper oder der „Mutter Courage“ oder Hauptmanns „Flo rian Geyer“. Dieser erste Eindruck war deprimierend, obwohl schon das Vorspiel (doch hierüber später) nicht gerade in weihevolle Stimmung versetzte. Doch mit dem Erscheinen des schönen silbrig glänzenden Schwans im Hintergrund und — als,, nach heftigem Lichtflakkern, Lohengrin in Silberrüstung, aus der Versenkung emporgehoben, plötzlich vor uns steht — werden die Farben der von vier bis sechs Soffitten gerahmten Bühnenbilder lichter, die Gewänder luxuriöser, zum Teil auch schön: Es ist eine andere Welt, sozusagen, in die sich die „alte“ verwandelt. Und dies haben Herz und Heinrich auch so gewollt. Das Heil ist gekommen, und mit geradezu kindlichem Vergnügen lassen sie eine ganze Kette von Zeremoniells ablaufen. Da sind zum Beispiel, vor dem Brautzug mit mächtigen Besen Weihwasser sprengende Geistliche am Werk; allerlei sakrale Kostbarkeiten werden über die Bühne getragen; der Marsch zum Münster, wie in alten Tagen, man weiß nicht, soll man weinen oder lachen. Denn bös ist es doch wohl nicht gemeint?
Aber dann, bei der Vorbereitung zur Hochzeitsnacht, da geschieht es: daß sich nämlich der Realismus in seinen eigenen Schwanz beißt: das riesige Brautlager wird erst abgedeckt, dann ein weißes, ein blütenweißes Leintuch sorgsam drübergebreitet, dann kommt wieder die Überdecke drauf und wird halb aufgeschlagen: Man wird geradezu mit dem Kopf auf das Bonmot Leo Slezaks gestoßen, der einmal sagte: „Gleich, wenn der Vorhang aufgeht, merkt man, daß das keine gemitliche Hochzeitsnacht werden wird.“ Und also geschieht es ja dann auch: sie endet mit Mord und Totschlag, Streit und Trennung für immer. — Während dieser tragischen Szene gab es einige Lacher — wie auch schon vorher. Das mag man betrüblich finden —, aber diesmal wurden sie vom Regisseur — sicher unfreiwillig — provoziert.,.
Doch nun zu den Sängern. Für den kurz vor der Premiere erkrankten James King sprang William Cochran ein und bot eine sehr respektable Leistung, obwohl mehr als Sänger denn als Darsteller für den Lohengrin geeignet. Hannelore Bode sang mit schönem Timbre und berührendem Ausdruck die Elsa, ihr Sopran von mittlerer Größe war den Anforderungen voll gewachsen. Was die Aussprache betrifft, so lispelt sie zuweilen ein wenig (aber das ist ja für viele Männer, wer weiß, vielleicht auch für Lohengrin, ein zusätzlicher, oft unwiderstehlicher Reiz). — Etwas unprofiliert und we nig glanzvoll: Peter Meven als deutscher König und Siegmund Nims- gern als Telramund, beide mit einem merkwürdig hell klingenden Bariton ausgestattet. Ebenso Hans Helm als Heerrufer. — Glanzstück und eindrucksvollste Leistung des Abends: Christa Ludwig, in Spiel und Gesang gleichermaßen bewunderungswürdig. Nur die rotbraune (nicht schwarze!) Perücke schien ihr im 1. Akt Schwierigkeiten zu machen. Auch Elsa war mit ihrem strengen Mittelscheitel ungünstig frisiert. Und mehrere Kostüme waren alles andere als „kleidsam“ (Wieland Wagner pflegte seine Götter und Helden stets mit modischer Eleganz, ob in Gold oder Süber, Blau oder Weiß, anzuziehen). Zubin Mehta am Pult, schon bei seinem Erscheinen stürmisch begrüßt, hatte die Zügel fest in der Hand, musizierte mit Präzision und Temperament. Aber von jenem gewissen Etwas, jener zauberischen Stimmung, die diese Musik unter den großen Wagner-Dirigenten ausstrahlt (überflüssig, ihre Namen zu nennen) war an diesem Abend kaum etwas, fast nichts, zu verspüren. — Doch dies wiederum spürte das Publikum, jedenfalls das jugendliche auf den Stehplätzen, nicht und feierte seinen Mehta stürmisch, wogegen der arme Norbert Baiatsch, den man offenbar für den Regisseur hielt, heftig ausgebuht wurde, als er sich mit den Darstellern am Schluß der Vorstellung zeigte. Ein Irrtum also, aber was für ein beschämender, zumal einige Männerchöre zum Eindrucksvollsten dieser Aufführung gehörten.
In Summa: War diese Neuinszenierung notwendig? Von allen im Repertoire befindlichen Wagner- Opern ist die des „Lohengrin“, die Wieland Wagner hier vor zehn Jahren machte, die weitaus gelungenste. In dieser Oper hat er (1958 in Bayreuth), erstmals gemeinsam mit seinem Großvater, das heißt auf dessen Spur, den Schritt von der Oper älteren Stils zum szenischen Oratorium getan: mit streng gegliederten Chormassen, wo immer möglich symmetrisch angeordnet, ebenso wie die Gegenspieler, i Kein. romantisches Erlösungsdrama, sondern eher eine oratorienhafte Kulthandlung, und trotzdem immer spannend. (Der Chor in seiner Inszenierung war eine Gemeinde von Wundergläubigen, keine Volksmasse.) Und mit Wieland Wagners Poesie in Blau entstand, aus Traum und Stilisierung, jene Zaubersphäre, in der Wagners Musik zu Hause ist. — Hiervon war in der besprochenen Aufführung leider wenig zu spüren.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!