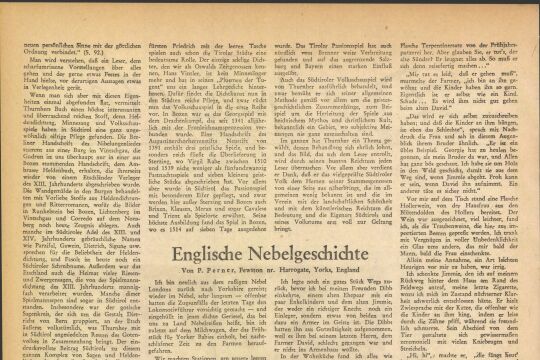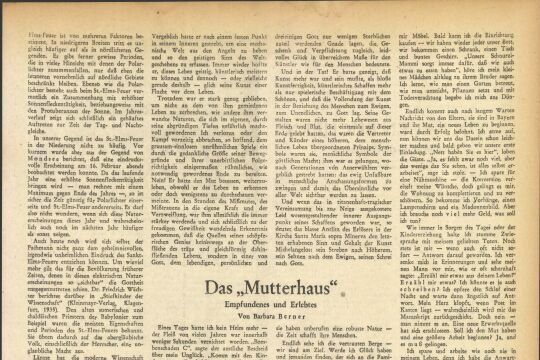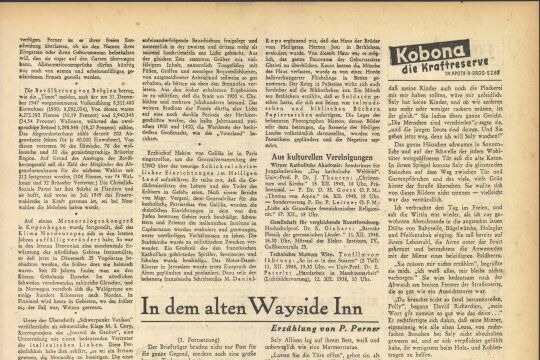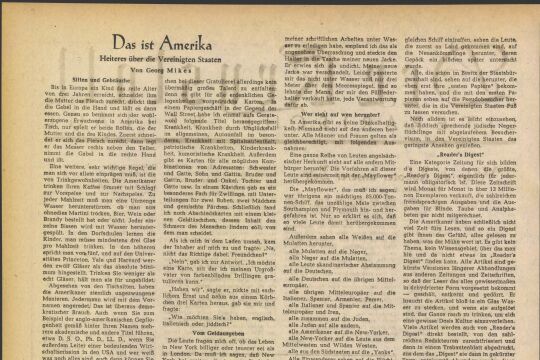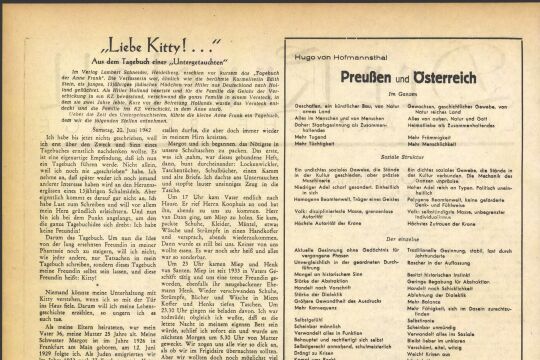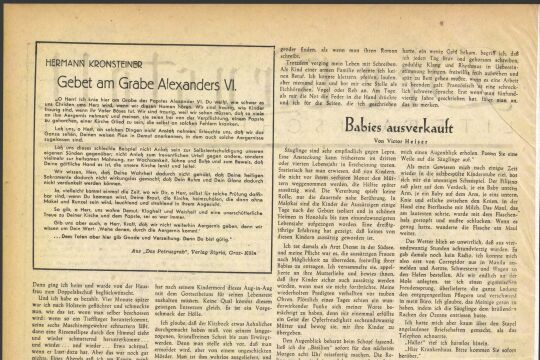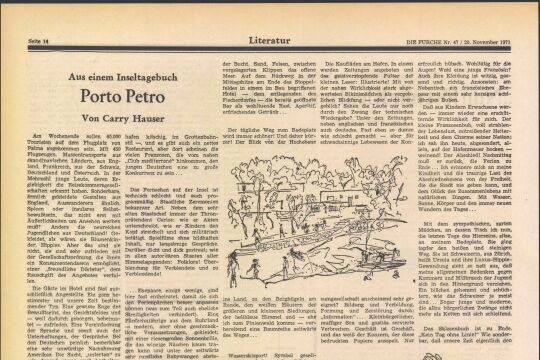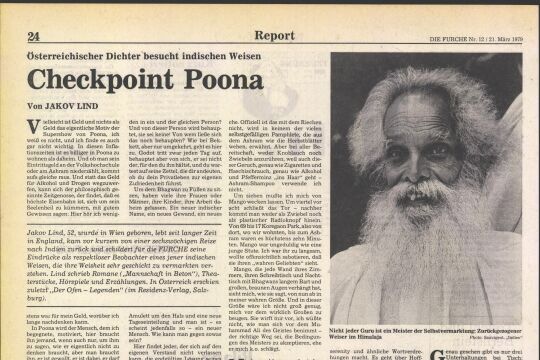Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Zu Gast bei den „Angels of Harlem"
Kurz vor sechs Uhr früh ist es im Winter in New York noch dunkel und die U-Bahn genau so, wie man sie eigentlich lieber nicht kennenlernen wollte: Die Abteile sind fast leer und die wenigen anderen Fahrgäste im Zug Richtung Harlem/The Bronx steigen meist schon in Mid-town Manhattan wieder aus.
Kurz vor sechs Uhr früh ist es im Winter in New York noch dunkel und die U-Bahn genau so, wie man sie eigentlich lieber nicht kennenlernen wollte: Die Abteile sind fast leer und die wenigen anderen Fahrgäste im Zug Richtung Harlem/The Bronx steigen meist schon in Mid-town Manhattan wieder aus.
Den Schmuck habe ich abgelegt, die Handtasche zu Hause gelassen. So gehe ich im ersten Morgengrauen die Stufen der Station hinauf, hinaus auf die 125. Straße, auf der schon einige Schulkinder und Geschäftsleute, Hausfrauen und Händler unterwegs sind. Zwischen dem Schneematsch glitzern Glasscherben und einerder Müllsäcke an der Straßenek-ke ist geplatzt; sein Inhalt hat sich über den Gehsteig ergossen.
Ziel meiner morgendlichen „Reise" ist das Haus der Schwestern der Mutter Teresa in Harlem, Ecke Mor-ningside Avenue und 127. Straße, gleich neben der St. Josephs Church.
Der dunkle Backsteinbau macht einen noch wenig belebten Eindruck, doch davor steht schon eine Handvoll Obdachloser und wartet auf die Nummernausgabe für das Essen. Einige haben Papier und anderes brennbares Material in den großen eisernen Mülleimer an der Ecke geworfen und es angezündet und wärmen sich nun am Feuer.
Seit über 20 Jahren sind die „Mis-sionaries of Charity", die Schwestern der Mutter Teresa, in ihren unverkennbaren weißen Saris mit den blauen Streifen in Harlem und haben Unzähligen zu essen und so vielen wie möglich - wenigstens für kurze Zeit -ein Dach über dem Kopf gegeben.
Der Arbeitstag beginnt für die Schwestern und die „Volunteers", die Freiwilligen, auch in Harlem um sieben Uhr früh mit der Heiligen Messe, die entweder in der Kapelle im ersten Stock oder in der Kirche nebenan gelesen wird. Bevor wir hinuntergehen und uns in der Küche die Schürzen umbinden, um mit der eigentlichen Arbeit zu beginnen, beten wir: „... um unseren Mitmenschen, die in Armut und Hunger sterben, zu dienen. Gib ihnen durch unsere Hände ihr tägliches Brot und durch unsere verständnisvolle Liebe Friede und Freude."
Was in den nächsten Stunden passiert, widerspricht eigentlich jeder Logik: innerhalb kürzester Zeit wird in riesigen Töpfen Suppe für mindestens 200 Personen (am Monatsende sind es meist noch mehr, zu „Thanks-giving" haben wir an die 500 Personen versorgt) gekocht, wird Salat gemacht und Brot, „Doughnuts", Obst und Kaffee vorbereitet, ohne daß jemand das Kommando übernehmen und so auch den Überblick bewahren würde. Immer ist eine Hand genau da, wo sie gerade gebraucht wird, und wenn die erste Gruppe hungriger Obdachloserinden Speisesaal strömt, ist meist schon alles fertig.
Am Anfang war ich erschrocken, wie jung und scheinbar gesund die „Homeless", die Unterstandslosen, sind. Aber man kommt gar nicht dazu, sich lange darüber Gedanken zu machen, denn in den folgenden Stunden gilt es, unzählige Teller zu füllen, auszuteilen, abzuwaschen und abzutrocknen, die Tische zu putzen und für die nächste Gruppe zu decken.
All das kann natürlich nur funktionieren, wenn gewisse Regeln - die sich im Lauf der Jahre bewährt haben - eingehalten werden, und doch hat diese soup-kitchen wie alle anderen im Sinn der „Speisung der 5.000" etwas Biblisches an sich: Die Schwestern geben, geben mit beiden Händen, und meines Wissens gab es noch nie den Tag, an dem sie nichts zu verteilen hatten.
Ein Großteil der geschenkten Nahrungsmittel für das Haus in Harlem kommt aus New Jersey. Großbäckereien, Gemüsehändler und Supermärkte überlassen den Schwestern (teilweise schon seit Jahren), was sie an verderblicher Ware nicht noch am selben Tag verkaufen konnten.
Brian zum Beispiel fährt schon jahrelang zweimal wöchentlich mit seinem Lieferwagen zum Haus der Sisters. Anfang Dezember hat er sich einen Tag freigenommen, um zusammen mit seiner Frau zu sehen, „was denn in der soup-kitchen damit geschieht"; da stand er dann in der Küche und wusch Salat, schälte Äpfel, servierte den Homeless und trocknete mit erstaunlicher Geschwindigkeit -so als habe der Bankangestellte schon lange in einer Großküche gearbeitet -die im brühend heißen Wasser gespülten Plastikteller ab.
Jeden Montag kommt auch ein junger Priester mit vier oder fünf „College-Kids" von New Jersey nach Harlem. Ich weiß nicht, wie er die Jugendlichen - die ihren Namen auf einen Zettel geschrieben haben und dann gezogen wurden (und denen ihre Eltern oft noch im letzten Moment diesen „Ausflug" verbieten)- auf den Tag vorbereitet. Aber es ist beeindruckend zu sehen, wie diese 17- bis 18jährigen sich anfangs noch „cool" geben, dann befremdet kichern, wenn beim Gemüseputzen Rosenkranz gebetet wird und immer stiller werden, je näher der Moment der Essensausgabe kommt. Einige würden sich am liebsten in der Küche verkriechen und müssen erst von Father Bob dazu überredet werden, doch im Speisesaal beim Servieren zu helfen. Am Ende des Vormittages waren dann noch immer alle „erschöpft, aber glücklich" und wurden zur Belohnung -typisch amerikanisch - zu „McDonald's" ausgeführt.
Sechsmal in der Woche wird auf dem Gasherd in großen Töpfen Suppe gekocht, nur am Donnerstag bleibt die Küche geschlossen (diese Regelung gilt in fast allen Häusern der Schwestern). In Harlem beschränkt sich die Belegschaft unter der Woche meist auf einige der Sisters, die dann alle Hände voll zu tun haben; am Wochenende gibt es meist genügend Freiwillige. Nur Barbara ist jeden Tag da: Seit ein paar Wochen lebt sie ganz bei den Sisters, steht auf dem Schemel und rührt mit einem überdimensionalen Kochlöffel in den großen Töpfen und spricht nur wenig über ihr Leben, bevor sie nach New York und ins Haus der Schwestern gezogen ist.
Und dann ist da auch noch Patricia: Ich weiß nicht, wann sie die Schwestern aufgenommen haben. Sie ist ein ech'er Sozialfall und für das Besteck und die Servietten zuständig; einmal in der Woche staubt sie auch die Statue des Hl. Joseph im Speisesaal ab. Meistens ist sie ganz ruhig, nur einmal habe ich einen ihrer Anfälle erlebt, während der sich ihr Gesicht fast bläulich-violett verfärbt und sie einfach losbrüllt und solange brüllt, bis es einer der Schwestern gelingt, sie wieder zu beruhigen.
Auch die Arbeit in der soup-kitchen kann zur Routine oder auch zur liebgewordenen Gewohnheit werden. „Gib meinen Händen Geschick, meinem Geist eine klare Sicht, meinem Herzen Sympathie und Freundlichkeit; gib mir Kraft, wenigstens einen Teil der Last des Leidens meiner Mitmenschen zu tragen und einen klaren Blick auf das Privileg meiner Last."- So beten die Schwestern und ihre Helfer jedesmal, bevor die erste Gruppe hereinströmt.
Und auch die Homeless beten vor dem Essen mit einer der Schwestern. Jeden Tag dasselbe und doch jeden Tag neu beeindruckend, wenn mit ungelenken Fingern Kreuzzeichen gemacht und - einige unsicher, andere mit fester Stimme - die Worte des „Vater-Unser" und eines kurzen Tischgebetes gesprochen werden.
Beim Servieren vergesse ich dann regelmäßig das frühe Aufstehen und die (anstrengende) Küchenarbeit, wenn eines meiner „good mornings" beim Hinstellen des Tellers mit einem Blick, einem Lächeln oder sog?r einer ähnlichen Begrüßung erwidert wird. Meist läuft alles problem- und reibungslos ab, doch natürlich ist nicht alles so rosig und einfach: am ersten Tag, als ich dort war, muß es noch auf der Straße eine große Schlägerei gegeben haben. Bevor das Essen ausgeteilt wurde, hat Sister Paul-Joseph - die Oberin des Hauses - laut überlegt, ob es sinnvoll ist, Essen auszugeben, wenn die Obdachlosen ihren Aggressionen dann gestärkt mit physischer Gewalt Platz machen.
Immer wieder muß die Rettung kommen, um einen der Drogenabhängigen mit Entzugserscheinungen ins Spital zu bringen. Einmal war ich dabei, als ein randalierender Obdachloser nur mit Hilfe der Polizei gewaltsam aus dem Speisesaal „entfernt" werden konnte. Du selbst stehst dann da, die Schürze um den Hals, einen Schöpflöffel in der Hand - und schöpfst weiter Suppe in eine der Schüsseln, stellst sie auf einen Teller, gibst ihn weiter, ... scheinbar ungerührt, (schon) so abgestumpft?
In der Küche wird streng zwischen Geschirr, das „nur" zur Zubereitung verwendet wurde und solchem, das die Homeless benützt haben, unterschieden; Löffel und Becher werden nicht nur mit kochend heißem Wasser und in einer Lösung, die konzentriert genug wäre, um „ganze Rinderherden" zu töten, gewaschen, sondern zusätzlich auch noch desinfiziert. Am Eiskasten klebt ein Gebet gegen „contagious diseases", gegen anstek-kende Krankheiten, und besonders die Obdachlosen selbst achten peinlichst genau darauf, daß keiner der anderen ihr Essen berührt...
Irgendwann gegen Mittag ist die Schlacht geschlagen, auch noch der letzte Zuspätkommende versorgt, alles abgewaschen und aufgeräumt.
Ivan ist fast täglich unter den letzten, die den Besen in die Ecke stellen. Der junge Farbige kommt schon lange hierher; vor ein paar Jahren hat er einen Job gefunden und ist in eine andere Gegend gezogen, jetzt ist er wieder arbeits- und obdachlos und jeden Tag im Haus der Sisters. „Es tut gut, sich zu betätigen", sagt er. Wir lassen uns von einer der Schwestern das Haustor aufsperren. „Wo gehst du hin?", fragt er, als wir an diesem kalten Tag auf der Straße stehen. „Heim", sage ich und bereue es im gleichen Moment. „Well", sagt er mit einem schüchternen Grinsen, „Ich gehe -auch wohin" und marschiert mit seinen Plastiksackerln die Straße hinunter, während ein paar Meter von mir entfernt ein Mann eine Telefonzelle demoliert, um sich die herauskollernden Münzen einzustecken.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!