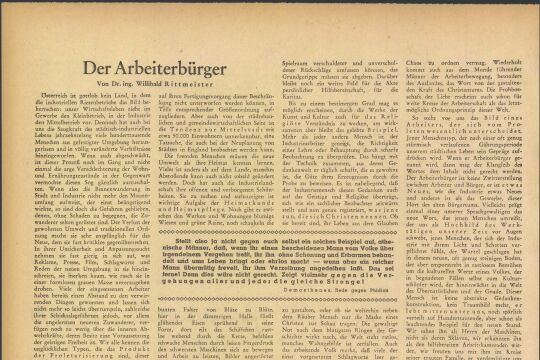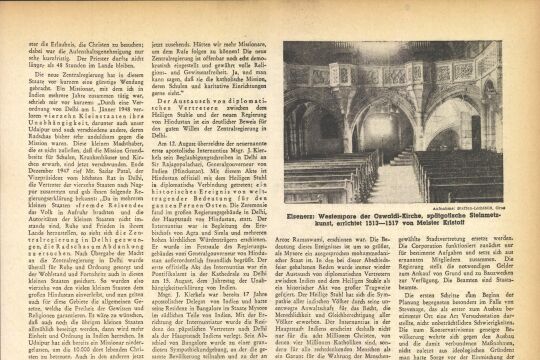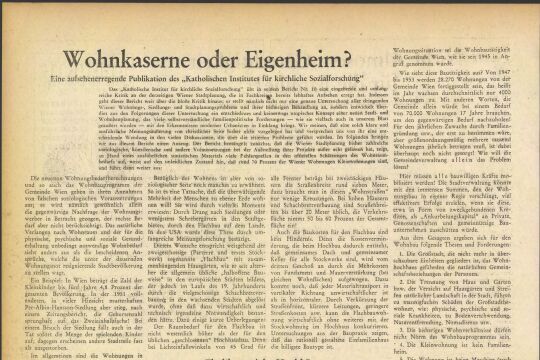Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Zum Wohnen gehört mehr als ein Dach
Bei den Dichtern, den Intellektuellen und selbst bei den schlichten Bewohnern ist das Verhältnis zur Großstadt ambivalent: einmal wird der Glanz, die Fülle der Möglichkeiten gepriesen — einmal wird die Enge, die Verderbtheit, die Unmenschlichkeit verflucht. Ältere (W. H. Riehl, O. Spengler)
und neuere (z. B. L. Mumford, A. Mitscherlich) Großstadtkritik wurde von Großstädtern geschrieben. Doch unverändert schreitet der Urbanisierungsprozeß fort, alle 20 Jahre verdreifacht sich weltweit die Stadtbevölkerung. Arbeit, Aufstiegschancen, Freiheit, Mannigfaltigkeit sind die Attraktionen.
Wo zuerst die Stadt zu groß geworden war und sich nur sehr wenige die Saisonwanderung zwischen Stadtpalais und Landgut leisten konnten, in London, wurde auch am frühesten über eine humane Lösung nachgedacht. Ebe- 1 nezer Howard wollte den „Magnet Stadt“ (hohe Einkünfte, jedoch hohe Lebenskosten, schlechte Luft) mit dem „Magnet Land“ (niedrige Einkünfte, aber dafür niedrige Kosten, gute Luft) verbinden und er erfand um 1890 die „Gartenstadt“.
Die Gärtlein des Leipziger Arztes Dr. Daniel Schreber sollten der Ausweg für die kleinen Leute sein. Der New Yorker Architekt C. A. Perry (1929) und der belgische Urbanist G. Bardet (ab 1940) forderten, daß die Großstadt in „Nachbarschaften“ und Bezirke mit „Subzentren“ überschaubar zu gliedern sei.
Immer wieder tauchte auch die Idee eines „Grüngürtels“ auf, der, leicht erreichbar, die Stadt mit unverbrauchter Natur umschließen sollte. Für Wien dürfte diese Idee von der Gräfin Adelheid Po- ninski vor mehr als hundert Jahren geboren worden sein, nach der dann Eugen Fassbender den durch den Gemeinderat preisgekrönten Entwurf eines „Wald- und Wiesengürtels“ schuf, der wiederum von Bürgermeister Lueger 1905 tatsächlich begonnen, aber nur zur Hälfte verwirklicht wurde. Das Grün auch in die Stadt hineinzuziehen und damit das Häusermeer aufzulockern, blieb Forderung und Traum. Nur im Nordwesten Europas gibt es „gegliederte und aufgelockerte“ Großstädte mit Einfamilienhäusern als überwiegender Wohn- form. Die zwei Dutzend „Neuen Städte“ in England bleiben weltweit Vorbild.
Von den Vereinigten Staaten über Europa bis Sibirien kennen wir gleichförmig häßliche, monotone, ungesunde Großstädte. Sie sind zu groß, zu hoch und zu dicht verbaut, stehen vor dem Verkehrsinfarkt und sind voller Kriminalität. Es müßte nicht so sein! Der Grüngürtel um London, die aufgelockerten New Towns, die in Viertel gegliederten holländischen Großstädte existieren und funktionieren tatsächlich. Man müßte es bei uns nur nachmachen.
Eine Stadtplanung nach den geschilderten Maximen bringt Luft, Platz, Grün zwischen die Häuser und verbessert die Wohnbedingungen in der Großstadt außerordentlich. Dafür braucht man nicht mehr Raum oder Geld — Rainer, Göderitz, Hoffmann und andere haben es bewiesen —, nur etwas mehr planerische Intelligenz und politischen Willen. Schließlich haben wir auch in Wien schüchterne Ansätze dieses gesunden, „modernen“ Städtebaus: die Genossenschaftssiedlungen der zwanziger Jahre, PAH-Siedlung- West aus der Nachkriegszeit oder die neue Südstadt.
Aber der Mensch lebt nicht vom Raum allein. Genauso wichtig wie
„Je größer die Stadt, um so zahlreicher und unkonventioneller sind auch deren Subkulturen im Positiven wie im Negativen“
genügend Platz sind ansprechende soziale Beziehungen. Psychologen und Soziologen wissen ebenso wie alle vereinsamten Menschen um die Wichtigkeit sozialer Kontakte. Bei der Vielzahl von unverbindlichen täglichen Begegnungen des Großstädters bleibt die Sehnsucht nach persönlichem Umgang, Hilfe, Geborgenheit in einer kleinen Gruppe. Tatsächlich ist davon mehr da als man ahnt. Der heutige Großstädter ist nicht „vermasst“ oder „entwurzelt“. Die meisten treffen oft Verwandte und Bekannte und sind wo „daheim“. Aber nicht alle; und für viele sind die Sozialbeziehungen behindert, erschwert, gestört. Frau Zapf und Prof. Herlyn haben gezeigt, wie die Nachbarschaftskontakte von der Kleinhaussiedlung über das städtische Wohnhaus zum Hochhaus hin abnehmen. Die Zahl der Personen im Verkehrskreis wird trotz der Menge der Bewohner kleiner.
Je größer die Stadt, umso zahlreicher und unkonventioneller sind auch deren Subkulturen, vermerkt C. S. Fischer. Im Positiven wie im Negativen. Unter einer Million Einwohnern gibt es eben immer genügend Leute, die eine Musikkultur, Bergsteigerklubs, Vorstadtvereine oder auch kriminelle Banden bilden; es entstehen Jugendtreffs und Altenlokale und die Traditionen werden weitergegeben. Subkulturen — seien es eigene Leute oder auch fremdsprachige — erzeugen auch Konflikte, die ausgetragen und geschlichtet werden müssen. Dazu kommen die Differenzen aus der unterschiedlichen Lebensweise sozialer Schichten. Schwerarbeiter im Schichtdienst haben einen anderen Lebensrhythmus als Zeitungsredakteure; deshalb wohnen sie auch in verschiedenen Stadtvierteln.
Immer mehr werden diese Strukturfaktoren weiteren Kreisen bewußt! Mehr Freizeit, höhere Einkommen, zunehmende Aus bildung ermöglichen es der Bevölkerung, über ihr Schicksal als Großstadtbewohner nachzudenken, um schließlich die Lösung der Probleme öffentlich zu fordern. Die Nachteile der städtischen Agglomeration treffen alle. Mitbestimmung oder Partizipation bei der Gestaltung der eigenen Umwelt wird daher zur Dauererscheinung werden.
Gut so! Für seine Wohnung, hinsichtlich des Verkehrs in seiner Gasse, Versorgung mit Schulen, Kirchen, Geschäften, Spielplätzen, ist jeder „Experte“. Jedenfalls mehr als der Bürokrat am grünen Tisch. Kind und Hausfrau und Bürger wissen ungefähr,
„Für seine Wohnung, hinsichtlich des Verkehrs in seiner Gasse, Versorgung mit Schulen, Kirchen, Geschäften ist jeder Experte“
was sie brauchen und was ihnen in ihrer Stadt abgeht. Wenn sie irren, zahlen sie auch dafür; mit jedem Eislutscher, jedem Bier, jeder Monatsmiete tragen sie Steuern und Gebühren zur Behörde. Die soll dafür ordentlich arbeiten und die Leute etwas mitreden lassen.
Eine Wohnung besteht nicht bloß aus Quadratmetern mit Wänden und Dach. Dazu gehört auch eine schöne Aussicht, gute Luft, erträglicher Lärm, angenehme Nachbarn, ausreichende Dienstleistungen in naher Entfernung, guter Anschluß an das Verkehrssystem, rechtliche Sicherheit, mannigfaltiges Stadtbild, erstklassige Verwaltung der öffentlichen Angelegenheiten. Nur wenn das zur erforderlichen Wohnfläche hinzukommt, kann man vom angenehmen Wohnen sprechen. Es gibt solche Häuser und es gibt solche Viertel. Warum nicht in der ganzen Stadt Wien?
Der Autor ist ordentlicher Professor der Soziologie und Vorstand des Instituts für Soziologie der Universität Wien
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!