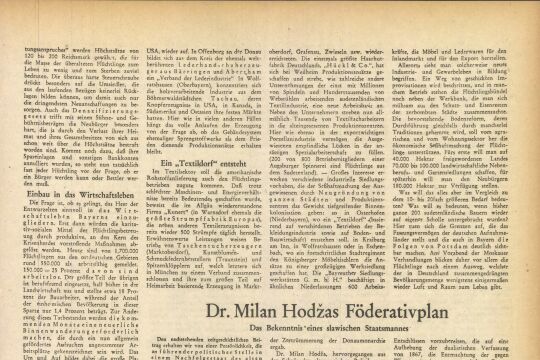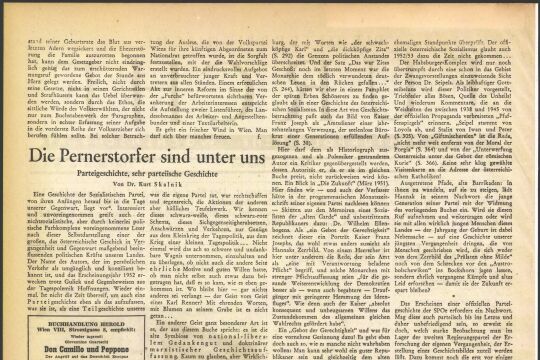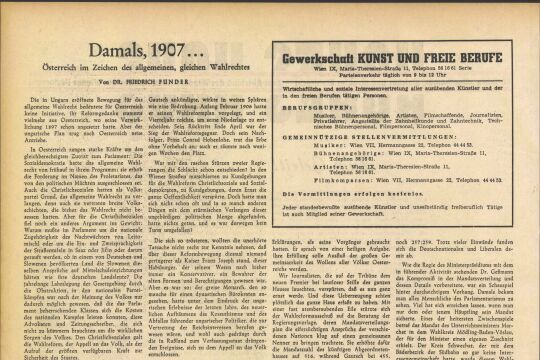Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Zwei Wanderer im Schneesturm
Seit Jänner 1987 flaggt man am Ballhausplatz in Wien wieder Rot-Schwarz. Auch am Beginn der Republik war die Zusammenarbeit der beiden Großen eher Notgemeinschaft.
Seit Jänner 1987 flaggt man am Ballhausplatz in Wien wieder Rot-Schwarz. Auch am Beginn der Republik war die Zusammenarbeit der beiden Großen eher Notgemeinschaft.
Nach einer kurzen Phase der Konzentration der Parteien des alten k. k. Reichsrates an der Wiege der jungen Republik bildete Staatskanzler Karl Renner nach der Wahl zur konstituierenden Nationalversammlung im März 1919 das erste Mal eine rotschwarze Regierung und vereinigte Sozialdemokraten und Christlichsoziale an einem Tisch.
Nach der militärischen Niederlage des 1. Weltkrieges und dem Auseinanderlaufen .der Völker der Donaumonarchie fanden sich also Vertreter sehr unterschiedlicher Traditionen und wohl auch Zukunftsvorstellungen gemeinsam auf einer Regierungsbank. Die Not des Augenblicks diktierte jedoch das Zusammengehen als eine eiserne Notwendigkeit.
Diese Gesinnung verdolmetschte Leopold Kunschak, einer der führenden Männer der Christlichsozialen Partei, in einer Parlamentsrede am 30. Mai 1919: „Unsere Vorstellung von der Koalition ist die einer loyalen Arbeitsgemeinschaft zum Zwecke der Erreichung ganz bestimmter Ziele, sie ist keine Liebesheirat, aber auch keine Vernunftehe, sondern eben nur eine Arbeitsgemeinschaft, der wir unsere besten Kräfte zur Verfügung stellen.“
Karl Renner als Staatskanzler war damals noch nüchterner in seiner Einschätzung dieser Koalition sehr unterschiedlicher Parteien. In einem sehr anschaulichen Bild verglich er die beiden Koalitionspartner mit zwei Wanderern, die im Gebirge in einen Schneesturm geraten waren und nun in einem Schneeloch gemeinsam Unterschlupf gefunden hatten. Sobald der Sturm abgeklungen sein wird, werden sie ihre Wanderung nach unterschiedlichen Zielen fortsetzen.
Bei einem solchen Minimum an Konsens braucht es nicht zu wundern, daß dieser ersten rotschwarzen Koalition kein langes Leben beschieden sein sollte. Denn es gab außer der Bewältigung des Tages mit seinen überreichen Problemen kaum einen gemeinsamen Plan zur Gestaltung der Zukunft.
Aber dieses Minimum an Konsens betraf nicht nur die Zukunft, es betraf auch die Vorstellungen über die Vergangenheit, aus der man kam. Die hohe Bedeutung, die wir dem Auseinanderklaffen in der Betrachtungsweise über das „Woher“ zumessen, mag fürs erste verwundern. Sie ist allerdings für Österreich signifikant.
Übrigens: Diese Bemerkung betrifft nicht allein den Rückblick auf die Jahre 1919 und 1920. Wenn man nämlich nicht weiß, woher man kommt, so findet man sich auf der Suche nach einem gemeinsamen Weg in die Zukunft nur schwer zurecht.
Hatten die Christlichsozialen nur aus der Not der Stunde ihre ursprüngliche Forderung nach einer Volksabstimmung über die Staatsform Monarchie oder Republik zurückgestellt, so pflegte die Linke lautstark den Mythos einer „österreichischen Revolution“ — so der Titel eines bekannten Werkes von Otto Bauer —, einer Revolution, die keine war. Entsprach doch die Gründung der Republik nicht einem lang zurückliegenden Plan, sondern erfolgte als eine Reaktion auf Umweltereignisse und auf die Absetzbewegungen der nicht deutschen Nationalitäten.
Was aber die beiden bald sich als „Lager“ — man beachte die militante Nomenklatur — empfindenden Parteien schied, waren nicht allein soziale und kulturpolitische Differenzen; es war auch die Einstellung zum Staat selbst -eben zu diesem Österreich.
Verknüpfte man auf der rechten Seite des Hohen Hauses mit dem Wort Österreich aus tieferen Gemütsregungen aufsteigende patriotische Empfindungen — zum Teü freüich allein auf rückwärts gewandter nostalgischer Basis —, so war Österreich für nicht wenige Wortführer der Linken damals nichts anderes als „ein verhaßter Name..., der uns fremd, ja feindselig entgegentritt, den wir gerade durch die Gründung unserer Republik verworfen und abgelehnt hatten“. So niemand anderer als der Chefredakteur der „Arbeiter-Zeitung“, Friedrich Austerlitz, in der 33. Sitzung der konstituierenden Nationalversammlung am 31. Oktober 1919. Und sarkastisch setzte er überdies hinzu: „Gott behüte uns alle, daß wir Österreicher werden.“
Auf dieser brüchigen Basis war es wahrhaftig schwer, einen Staat zu bauen und aus den Trümmern ein neues Gemeinwesen zu errichten, das allen Bürgern als gemeinsamer, ja erhaltens- und verteidigungswerter Hort erscheinen konnte.
Hauptleistung dieser Koalition war jedoch ohne Zweifel die Verhinderung einer Rätediktatur, wie sie sich in dieser Zeit in Bayern und in Ungarn etabliert hatte.
Die ersten Sturmzeichen für die rot-schwarze Koalition kamen 1920. Damals war Linz im Mai kurzfristig der Schauplatz bürgerkriegsähnlicher Szenen mit sieben Toten und 30 Verwundeten. Das Standrecht wurde verkündet.
Der Funke ins Pulverfaß, welcher dieser Großen Koalition ein Ende bereiten sollte, kam aus einem anscheinend nebensächlichen Anlaß. Er zündete bei einer Debatte über die Wahl der Vertrauensmänner in der bescheidenen bewaffneten Macht, welche sich die junge Republik eben anschickte zu schaffen.
Alle Versuche, den Bruch zu leimen, schlugen fehl. Sie fanden keine Unterstützung durch die Mehrheit der entscheidungsbe-fugten Gremien beider Lager.
Das Ende der rot-schwarzen Koalition im Juli 1920 und die darauffolgenden Neuwahlen, welche einen Wechsel in der Verlagerung der politischen Schwergewichte erbrachten, dürfen mit Recht — um mit Norbert Leser zu sprechen —„als entscheidende Weichenstellungen ersten Ranges“ in der Geschichte der Ersten Republik angesehen werden.
Das nächste Jahrzehnt gehörte dem „Bürgerblock“, einer Verbindung der Christlichsozialen mit den Großdeutschen und dem national-liberalen Landbund. Die Kluft zwischen Schwarz und Rot wird in diesem Jahrzehnt jedoch immer breiter. Sie wird schließlich zum Abgrund durch die Ereignisse rund um das Schattendorfer Fehlurteil und den in Brand gesteckten Justizpalast, mit zahlreichen Todesopfern in seinem Gefolge.
Dennoch führte auch über ihn noch so mancher Notsteg, wie die zähen Verhandlungen und die gemeinsam beschlossene Verfassungsnovelle 1929, die der reinen Parlamentsherrschaft ein Ende machte und die Stellung des Bundespräsidenten stärkte, beweisen.
Auch ist es eine verkürzte Optik, wenn der heutige Zentralsekretär der SPÖ, Heinrich Keller, in seinen erst unlängst verkünde-/ ten Thesen die Behauptung auf^ stellte, die Christlichsozialen waren fest entschlossen, die Sozialdemokraten von einer möglichen Koalition fernzuhalten.
Das mag für das Jahrzehnt zwischen 1920 und 1930 gelten. Kellers apodiktischer Feststellung widerspricht aber nachdrücklich das Koalitionsangebot im Jahr 1931, welches Ignaz Seipel in einer Stunde äußerster Bedrängnis — die Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise kamen mit dem Zusammenbruch der Creditanstalt und der damit verursachten Demission des Kabinetts von Bundeskanzler Otto Ender nun in Österreich voll zum Tragen — an die Sozialdemokraten richtete.
Seipel bot seinen Gesprächspartnern sogar nicht nur den Vizekanzler in der Person von Otto Bauer, sondern insgesamt vier Kabinettsposten an, während er sich für seine Partei mit drei bescheiden wollte. Das Angebot scheiterte sowohl an persönlichen Rivalitäten innerhalb der Sozialdemokratie wie auch letzten Endes am Doktrinarismus Bauers, der nicht „Arzt am Sterbebett des Kapitalismus“ spielen wollte.
Otto Bauer gab sich der trügerischen Hoffnung hin, die Zukunft werde gleichsam automatisch dem Sozialismus gehören — eine schwerwiegende Fehleinschätzung. Niemand anderer als Bruno Kreisky hat die Zurückweisung des Seipelschen Angebots aus historischer Sicht eindeutig kritisiert.
Die weitere Entwicklung darf als bekannt angenommen werden. Das Experiment des unter Ausschaltung der demokratischen Verfassung etablierten Ständestaates in einem von autoritären Staaten und Rechtsdiktaturen geprägten Mitteleuropa gab jedoch Österreich—das sollte man nicht verschweigen — eine Galgenfrist von vier Jahren vor der 1938 erfolgten Vereinnahmung durch das nationalsozialistische „Dritte Reich“.
Inzwischen tobt in der bedrängten Festung der Bürgerkrieg des Februars 1934. Dieser und noch mehr die dem Bürgerkrieg folgenden Todesurteile und Justifi-zierungen zerstörten für Jahre jede Gesprächsbasis zwischen Rot und Schwarz. Die Spätfolgen dieser Entfremdung werden bis in unsere Gegenwart offenkundig.
Als umso bedeutsamer muß man deshalb die Tatsache werten, daß sich nur elf Jahre nach den Kanonen des Februars 1934 Repräsentanten der einstigen Bürgerkriegsparteien zum gemeinsamen Aufbau eines neuen Österreich fanden.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!