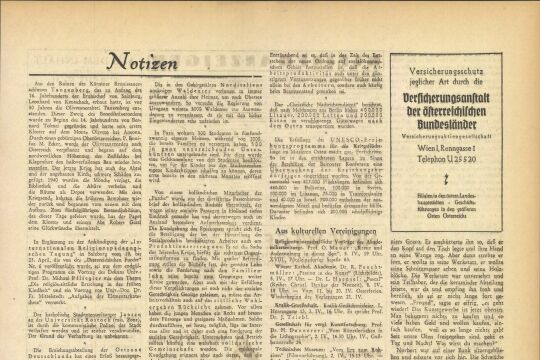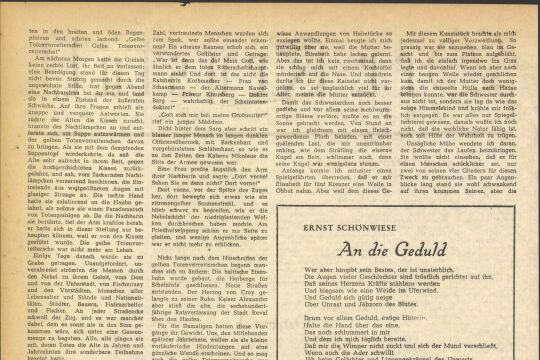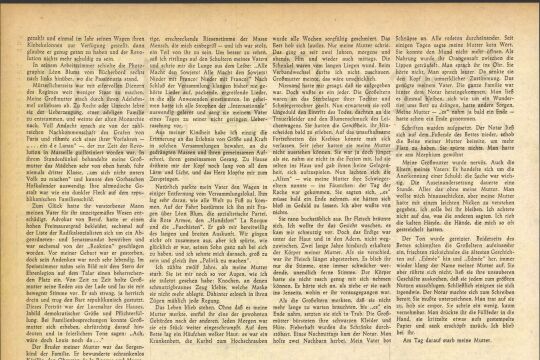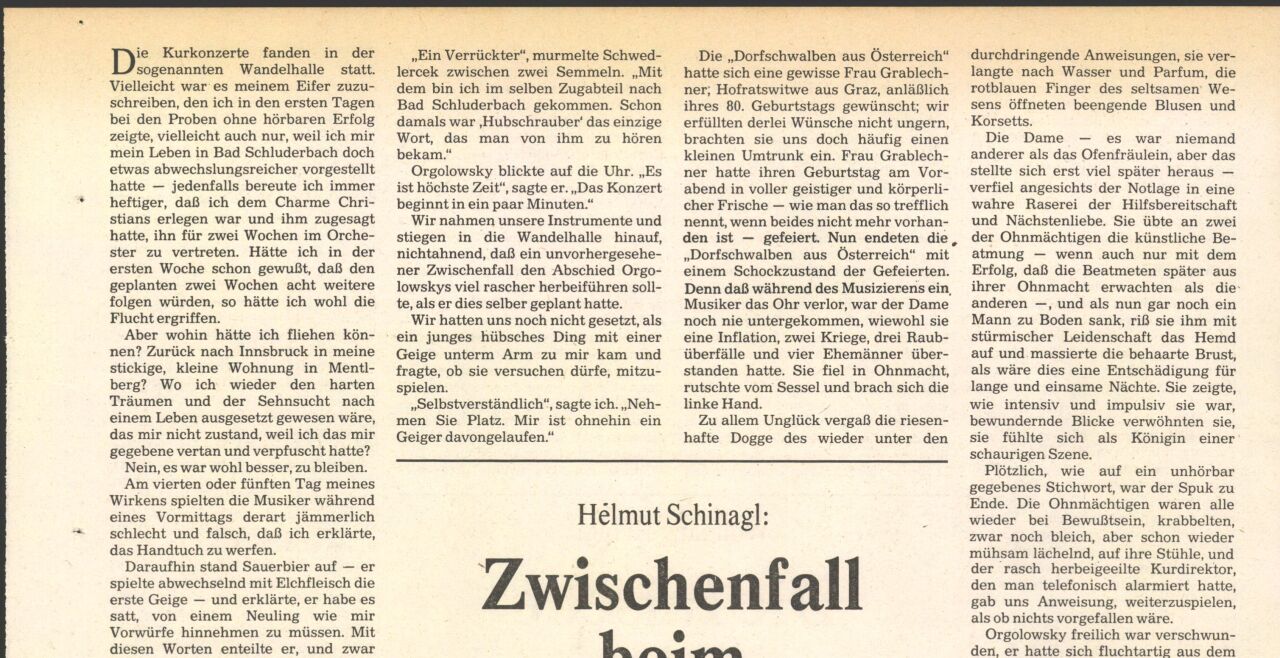
Die Kurkonzerte fanden in der sogenannten Wandelhalle statt. Vielleicht war es meinem Eifer zuzuschreiben, den ich in den ersten Tagen bei den Proben ohne hörbaren Erfolg zeigte, vielleicht auch nur, weil ich mir mein Leben in Bad Schluderbach doch etwas abwechslungsreicher vorgestellt hatte — jedenfalls bereute ich immer heftiger, daß ich dem Charme Christians erlegen war und ihm zugesagt hatte, ihn für zwei Wochen im Orchester zu vertreten. Hätte ich in der ersten Woche schon gewußt, daß den geplanten zwei Wochen acht weitere folgen würden, so hätte ich wohl die Flucht ergriffen.
Aber wohin hätte ich fliehen können? Zurück nach Innsbruck in meine stickige, kleine Wohnung in Mentl-berg? Wo ich wieder den harten Träumen und der Sehnsucht nach einem Leben ausgesetzt gewesen wäre, das mir nicht zustand, weil ich das mir gegebene vertan und verpfuscht hatte? Nein, es war wohl besser, zu bleiben. Am vierten oder fünften Tag meines Wirkens spielten die Musiker während eines Vormittags derart jämmerlich schlecht und falsch, daß ich erklärte, das Handtuch zu werfen.
Daraufhin stand Sauerbier auf — er spielte abwechselnd mit Elchfleisch die erste Geige — und erklärte, er habe es satt, von einem Neuling wie mir Vorwürfe hinnehmen zu müssen. Mit diesen Worten enteilte er, und zwar mitten im „Ständchen" von Karl Kom-czak. Sein plötzliches Aufstehen und Fortgehen beschäftigte die Zuhörer weit mehr, als es das Verschwinden der Musiker in Haydns Abschiedssinfonie weiland am Eszterhazyschen Hof getan hatte.
Nach seinem Weggang, gleichfalls noch während dieses Vormittagskonzerts, erklärte auch der Cellist, er denke höchstens noch ein paar Tage zu bleiben. Ich möge mir etwas einfallen lassen, wie ich sein dumpfes Brummen ersetzen könne. Schwedlercek, der zwischen den Stücken stets eilige Mahlzeiten zu sich nahm, machte sich sofort erbötig, das Violoncello zu streichen. Er habe schließlich, erklärte er, auch dieses Instrument einmal studiert. Aber schon ein Versuch, dies zu tun, scheiterte. Seine Arme waren zu kurz oder, besser gesagt, seine Leibesfülle zu groß, daß er hätte für Orgolow-sky einspringen können.
Niemand kann mir verdenken, daß ich nach dieser Eröffnung ziemlich deprimiert war. Ich weiß nicht, wieso sich damals in mir jener kitschige Satz festheftete, der auf Spruchkarten und gestickten Küchenhängern millionenfach verbreitet ist: „Wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her."
Schon am nächsten Vormittag kam nämlich tatsächlich so ein Lichtlein
Die Episode stammt aus dem Roman .Berenice oder Die Möbiusschleife", an dem der Autor zur Zeit arbeitet. Helmut Schinagl, Jahrgang 1931, ist Mitglied des österreichischen PEN-Clubs.
daher, auch wenn ich es zunächst nicht als solches erkannte.
Das Lichtlein tauchte auf in der Gestalt eines Mannes mit buschigen Augenbrauen. Der Mann schob sich mit gekrümmtem Rücken in den Probenraum und sagte laut und vernehmlich: „Hubschrauber".
Wir unterbrachen unser Spiel und blickten auf.
„Hubschrauber", sagte der Mann nochmals und deutete auf das Cello, worauf sich Orgolowskys Nackenhaare sichtbar sträubten.
Der sonderbare Besuch seufzte nur und verschwand wieder.
„Ein Verrückter", murmelte Schwedlercek zwischen zwei Semmeln. „Mit dem bin ich im selben Zugabteil nach Bad Schluderbach gekommen. Schon damals war ,Hubschrauber' das einzige Wort, das man von ihm zu hören bekam."
Orgolowsky blickte auf die Uhr. „Es ist höchste Zeit", sagte er. „Das Konzert beginnt in ein paar Minuten."
Wir nahmen unsere Instrumente und stiegen in die Wandelhalle hinauf, nichtahnend, daß ein unvorhergesehener Zwischenfall den Abschied Orgolowskys viel rascher herbeiführen sollte, als er dies selber geplant hatte.
Wir hatten uns noch nicht gesetzt, als ein junges hübsches Ding mit einer Geige unterm Arm zu mir kam und fragte, ob sie versuchen dürfe, mitzuspielen.
„Selbstverständlich", sagte ich. „Nehmen Sie Platz. Mir ist ohnehin ein Geiger davongelaufen."
Schwedlercek sprang von seinen beiden Sesseln auf und bot der jungen Dame seinen Platz an. Sie setzte sich etwas verlegen, allerdings nur auf einen Sessel.
„Ihr Erscheinen kommt mir sehr gelegen", sagte Schwedlercek und verbeugte sich galant vor dem Mädchen. Dann wandte er sich an mich. „Hermann, Sie haben doch nichts dagegen, wenn ich mich für heute entschuldige? Meine Frau ist ein wenig unpäßlich, ich muß ihr einiges zum Essen bringen."
Seufzend — was hätte ich sonst auch tun können — nickte ich. Dann begannen wir mit dem Konzert. Das Mädchen schlug sich erstaunlich gut. Von den zum Teil spektakulären Begleiterscheinungen seines Auftritts wird später noch ausführlich zu berichten sein. An dieser Stelle ist hierfür keine Zeit, denn mit Riesenschritten nahte das Ende der musikalischen Karriere Orgolowskys.
Unser Cellist, der eben noch vom Abschied in einigen Tagen gesprochen hatte, legte sich angesichts der jungen Dame gehörig ins Zeug. Das Imponiergehabe liegt ja allen Männern im Blut. Er wackelte mit dem Kopf, schlenkerte ihn hin und her, und ich befürchtete das Schlimmste für sein Ohr, mußte er es doch immer wieder gewaltsam gegen den Schädel pressen.
Und dann geschah tatsächlich das Unglück.
Orgolowsky mußte an jenem Tag Kukident verwendet haben, das kaum noch über Haftfähigkeit verfügte. Jedenfalls fiel ihm das künstliche Ohr während einer besonders schmelzenden Kantilene in den „Dorfschwalben aus Österreich" aus der Verankerung und rollte über den Boden hin.
Die „Dorfschwalben aus Österreich" hatte sich eine gewisse Frau Grablech-ner; Hofratswitwe aus Graz, anläßlich ihres 80. Geburtstags gewünscht; wir erfüllten derlei Wünsche nicht ungern, brachten sie uns doch häufig einen kleinen Umtrunk ein. Frau Grablech-ner hatte ihren Geburtstag am Vorabend in voller geistiger und körperlicher Frische — wie man das so trefflich nennt, wenn beides nicht mehr vorhanden ist — gefeiert. Nun endeten die. „Dorfschwalben aus Österreich" mit einem Schockzustand der Gefeierten. Denn daß während des Musizierens ein Musiker das Ohr verlor, war der Dame noch nie untergekommen, wiewohl sie eine Inflation, zwei Kriege, drei Raubüberfälle und vier Ehemänner überstanden hatte. Sie fiel in Ohnmacht, rutschte vom Sessel und brach sich die linke Hand.
Zu allem Unglück vergaß die riesenhafte Dogge des wieder unter den
Gästen weilenden Majors, die dem Konzert diesmal ohnehin schon laut knurrend und zähnefletschend gefolgt war, die letzten Reste ihrer guten Erziehung. Sie sprang aufs Podium, apportierte das Ohr und legte es dem Major vor die Füße. Daraufhin sank auch die Nachbarin des Majors in Ohnmacht, allerdings nur mit einem leisen Seufzer und lange nicht so polternd wie die Frau Hofrat.
Nun gibt es bekanntlich nicht nur eine Unzahl ansteckender Krankheiten, die durch Bakterien und Viren hervorgerufen werden, sondern auch eine Reihe psychischer, deren Infektion auf dem Weg des Sehens und Betrachtens erfolgt. Jedenfalls lösten diese beiden Ohnmächten ein halbes Dutzend weiterer Ohnmächten aus. Es plumpste, seufzte und krachte in den Zuschauerreihen, allgemeines Kreischen und entsetztes Hilferufen war zu vernehmen, der Tumult wuchs, und eine Panik brach wohl nur deshalb nicht aus, weil die Mehrzahl der Anwesenden schlecht zu Fuß war und erst Stöcke, Schirme, Taschen und sonstige prothetische Hilfsmittel hätte zusammensuchen müssen, ehe sie sich mühsam hätte erheben und schleifenden Gangs den Saal verlassen können.
In diesen Minuten allgemeiner Verwirrung schlug die große Stunde einer Person, die ich zuvor noch nie unter den Zuhörern wahrgenommen hatte. Es war eine äußerst häßliche, von großer Hagerkeit befallene Dame mittleren Alters, deren Nase schnabelartig aus dem Gesicht stach, während ihre dürren Hände bald wild gestikulierend in die Höhen fuhren, bald beruhigend auf den Zusammengefallenen ruhten. Ihre schrille Stimme gab klare und
durchdringende Anweisungen, sie verlangte nach Wasser und Parfüm, die rotblauen Finger des seltsamen Wesens öffneten beengende Blusen und Korsetts.
Die Dame — es war niemand anderer als das Ofenfräulein, aber das stellte sich erst viel später heraus — verfiel angesichts der Notlage in eine wahre Raserei der Hilfsbereitschaft und Nächstenliebe. Sie übte an zwei der Ohnmächtigen die künstliche Beatmung — wenn auch nur mit dem Erfolg, daß die Beatmeten später aus ihrer Ohnmacht erwachten als die-anderen —, und als nun gar noch ein Mann zu Boden sank, riß sie ihm mit stürmischer Leidenschaft das Hemd auf und massierte die behaarte Brust, als wäre dies eine Entschädigung für lange und einsame Nächte. Sie zeigte, wie intensiv und impulsiv sie war, bewundernde Blicke verwöhnten sie, sie fühlte sich als Königin einer schaurigen Szene.
Plötzlich, wie auf ein unhörbar gegebenes Stichwort, war der Spuk zu Ende. Die Ohnmächtigen waren alle wieder bei Bewußtsein, krabbelten, zwar noch bleich, aber schon wieder mühsam lächelnd, auf ihre Stühle, und der rasch herbeigeeilte Kurdirektor, den man telefonisch alarmiert hatte, gab uns Anweisung, weiterzuspielen, als ob nichts vorgefallen wäre.
Orgolowsky freilich war verschwunden, er hatte sich fluchtartig aus dem Staub gemacht, sein Cello — besser gesagt, das Instrument, das er benützt hatte, denn dieses war, wie alle anderen Instrumente auch, Eigentum der Marktgemeinde Bad Schluderbach — lehnte hilflos und verloren an der Wand.
Da stand der gedrungene Mensch mit den buschigen Augenbrauen wieder vor mir, der Verrückte, dessen flackernder Blick unvermeidbar an einen Irren denken ließ.
„Hubschrauber", sagte er. Dann holte er ein Blatt Papier aus der Tasche, kritzelte eilig einige Worte darauf und schob mir die Mitteilung hastig zu. „Ich würde gern bei Ihnen Cello spielen", las ich. „Ich bin ausgebildeter Musiker. Mein Name ist Markus Loibetseder."
Der Name ließ in mir Assoziationen zu quälenden Dissonanzen anspringen, ohne daß ich vorerst wußte, weshalb. Erst später verband ich den Namen dieses sonderbaren Gesellen mit dem jenes Komponisten, dessen Oper „Lymphdrüse" mir vor zwei Wochen allerhand seelische Verdrießlichkeiten bereitet hatte.
„Ich wäre sehr froh, wenn Sie für unseren Cellisten einspringen könnten", sagte ich. Der Mann nickte glücklich, nahm das Instrument auf, strich über die Saiten, stimmte nach. Dann stand er auf, verbeugte sich gegen das Publikum hin und sagte noch einmal laut und vernehmlich „Hubschrauber".
Die Menschen lachten. Es gibt nicht
nur ein Crucifige, das unmittelbar auf
ein Hosianna folgt, es gibt auch ein
ebenso unpassendes Gelächter, das
den Schock einer fatalen Situation überwindet. So spielten wir unser
Programm zu Ende. Ich blickte in den Saal. Die hagere Dame mit dem Schnabelgesicht war nicht mehr anwesend.
Doch in diesem Augenblick geschah, was ich schon vorhin erwähnt hatte. Auf der Suche nach dem urhäßlichen Gesicht stiegen urhäßliche Klänge in mir auf, und ich erkannte sie wieder. Sie stammten aus der Oper „Lymphdrüse".
„Sind Sie vielleicht mit dem Komponisten Loibetseder verwandt?", fragte ich den neuen Cellisten. „Hubschrauber", sagte der glücklich und nickte lächelnd.