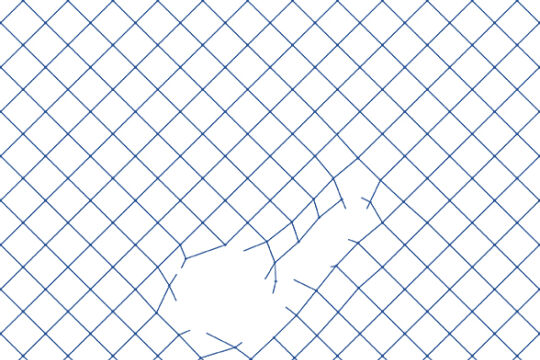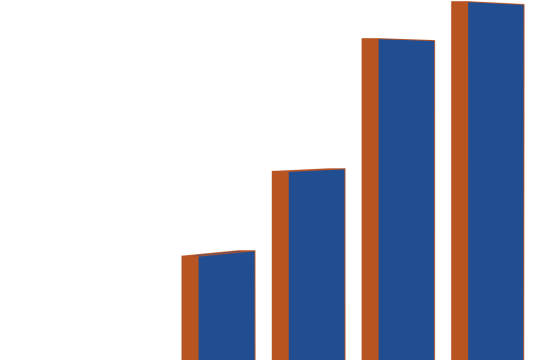Wie leben Menschen an der so genannten Armutsschwelle? Fühlen sie sich arm und wollen sie als "arm" bezeichnet werden? Immer mehr Menschen trauen sich, über ihr Leben in der "Armutsschublade" offen zu sprechen.
Als meine Bekannte, früher an der Akademie der Wissenschaften tätig, arbeitslos wurde, wurde sie von vielen Freunden plötzlich wie eine Aussätzige behandelt. Als ob die Leute ihre eigene Angst, arbeitslos oder arm zu werden, auf sie projiziert hätten. Durch diese Abwehr versuchten sie, ihre eigene Angst zu bekämpfen," erzählt Maria Wölflingseder, "als ob Armut ansteckend wäre."
Durch die zunehmende Berichterstattung über Armut und Armutsgefährdung wächst als unerwünschte Nebenwirkung auch die Angst davor. Obwohl, wie die promovierte Pädagogin hinzufügt, es sehr positiv sei, dass nun mehr darüber berichtet wird als etwa vor sechs Jahren, als die heute 49-Jährige plötzlich arbeitslos wurde. "Ich habe damals nicht gewusst, wovon ich leben soll. Ich wäre obdachlos geworden, hätte ich nicht Erspartes gehabt, von dem ich auch heute noch zehre. Aber bald ist es aufgebraucht."
Arbeitslos trotz Doktorat
Wölflingseder wird nicht müde, in Artikeln und Buchbeiträgen (etwa im Sammelband Dead Men Working) aufzuzeigen, dass auch Bildung nicht vor Armut und Arbeitslosigkeit schützt. "Natürlich bin ich arm, ich fühle mich arm", sagt sie. Die Akademikerin lebt zur Zeit von 750 Euro Notstandshilfe, die Miete allein beträgt 460 Euro. In den ersten Jahren lebte sie von 450 Euro Arbeitslosengeld. Sie berichtet von Schikanen durch das Arbeitsmarktservice sowie das Sozialamt. "Dort hört man Geschichten!" Sie erzählt von Firmen, die beim Job-Einstieg helfen sollten. "Wir vermitteln keine Akademikerstellen", bekam Wölflingseder zu hören. Ebenso dürfe sie als Arbeitslose nicht wegfahren. "Auf den Briefen, die das AMS regelmäßig schickt, steht drauf, dass eine Nachsendung dieser Poststücke nicht erlaubt ist." - Als wäre die Armut, die jede Reise fast unmöglich macht, nicht Gefängnis genug.
"Nein, wir fühlen uns nicht arm und armutsgefährdet", sagen die beiden jungen Studentinnen entschlossen, die am Stand ihrer Studentenvertretung vor der Hauptuniversität Informationsmaterial verteilen; obwohl ihre Einkommen nur knapp über der magischen Grenze von 726 Euro liegen. "Ich weiß, dass ich bessere Chancen habe", ist Barbara Posch, Doktorantin im Fach Politikwissenschaft, überzeugt. Auch ihre Kollegin Johanna Ernst, Mathematikstudentin, pflichtet ihr bei: "Ich werde immer einen Job finden." Zur Zeit werde eben gespart; etwa zwei Monate lang, um einen Mini-Computer kaufen zu können, und "gejobt". Nur den Luxus, öfter zu den Eltern heimzufahren, könnten sie sich eben seltener leisten.
Martin Mair will offen über seine Lage sprechen, im Unterschied zu vielen Leidensgenossen, die sich an den Gründer der Plattform "Arbeitslosennetz" wenden. "Viele sind psychisch einfach fertig", erzählt der 42-Jährige, "sie kommen sich als Menschen zweiter Klasse vor." Er selbst fühle sich "teilweise" als arm. Die Invaliditätspension von 660 Euro sei genug zum Überleben, aber zu wenig, um wirklich zu leben.
Zahnarzt nicht leistbar
"Viele Armutsbetroffene bräuchten eine Psychotherapie", sagt er: "Hoffentlich wird mein Durchlauferhitzer nicht kaputt. Außerdem, wie soll ich mir die Zahnbehandlung leisten? Gehören gesunde Zähne nicht auch zu den Grundbedürfnissen?" Auch die von ihm angestrebte Umschulung ist kaum leistbar. Der erwünschte Wifi-Kurs kostet 4000 Euro.
Mair erzählt von der Isolation, die viele seiner Bekannten empfinden. Selbst wenn ein Arbeitsloser in ein gefördertes Programm zur Reintegration in den Arbeitsmarkt aufgenommen wird, fühlen sich viele weiterhin als "Menschen zweiter Klasse". "Meine Bekannte fand durch ein solches Projekt Arbeit als Putzfrau. Sie bekommt zwar 800 Euro, muss aber davon Schulden abbezahlen. Sie wird nicht wie eine normale Mitarbeiterin behandelt." Auch seine Geschichte ist durchzogen von Kritik am AMS: "Die Leute sollten dort in den diversen Kursen nur ruhig gestellt werden. Da wird nur an der Statistik getrickst."
Regina Amer ist eine so genannte "Transitarbeitskraft". So werden jene Jobs genannt, die befristet vom AMS vermittel werden. Nach zehn Jahren Arbeitslosigkeit arbeitet die 47-Jährige Mutter von vier Kindern (teilweise erwachsen, teilweise nicht bei ihr lebend) als Putzfrau für 633 Euro. Bis Dezember muss sie eine neue Arbeit gefunden haben: "Ich möchte eine Stelle finden, von der ich auch leben kann." Amer fühlt sich stark unter Druck gesetzt: Vor dieser Arbeit bekam sie 519 Euro Notstandshilfe, würde sie wieder arbeitslos werden, bekäme sie nur 300 Euro vom AMS.
Eine Pensionistin, die ihrem Sohn in der Trafik in der Alserbachstraße im neunten Bezirk aushilft, hat hingegen wenig Verständnis für die Diskussion um zunehmende Armut. Sie selbst müsse mit "unter 1000 Euro" Pension auskommen. Auf die Frage, ob sie sich arm fühle, meinte die 70-Jährige, die ihren Namen nicht nennen wollte, ablehnend: "Ich musste mein ganzes Leben sparen. Ich habe über 40 Jahre im Verkauf gearbeitet. Als ich 1951 zu arbeiten angefangen habe, verdiente ich 26 Schilling die Woche." Das Grundsicherungsmodell hält sie daher auch für unfair: Sie kenne viele, die trotz Arbeit weniger als 726 Euro verdienten.
In der "Selbsthilfegruppe für Menschen in schwierigen Lebenssituationen" treffen sich jede Woche acht Männer, um über ihr Erlebtes zu reden. Ein bunt gemischter Kreis von Arbeitslosen und Frühpensionisten. "Sie alle leben unter der Armutsgrenze", erklärt Peter Gach, Leiter der Gruppe. Der frühere Druckereimitarbeiter muss von 578 Euro Sozialhilfe und Notstandshilfe leben. Das Grundsicherungsmodell würde er begrüßen. "Die Sozialhilfe gehört total reformiert. Am Sozialamt wird man nicht informiert, jeden Anspruch, den man hat, muss man sich hart erkämpfen."
Armut sichtbar machen
Der 57-Jährige geriet 1988 in eine Krise, aus der er erst nach zehn Jahren Lethargie wieder herausgekommen ist. Durch Todesfälle in der Familie war er psychisch so angegriffen, dass er in der Arbeit nicht mehr mithalten konnte. Er wurde gekündigt. "Einen ganzen Winter war das einzig warme, das ich gegessen habe, eine Leberkässemmel", erzählt er heute nüchtern über diese schwere Zeit. Erst als er sich zu einem Kurs aufraffen konnte, fand er wieder ins normale Leben zurück. "Ich lernte Menschen kennen, die noch Schlimmeres erlebt haben."
"Ich bin arm, aber ich versuche, mit meinen kreativen Möglichkeiten Mängel auszugleichen", erzählt Gach. Berichte über Armut würden einerseits das Selbstbewusstsein vieler noch weiter knicken, aber andererseits würde dadurch manchen erst bewusst, dass sie auch arm seien, und sich dagegen zur Wehr setzen müssten.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!















































.png)