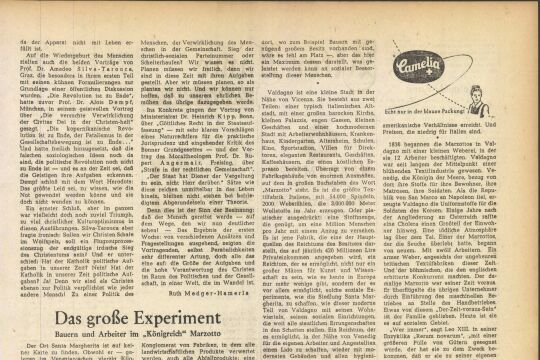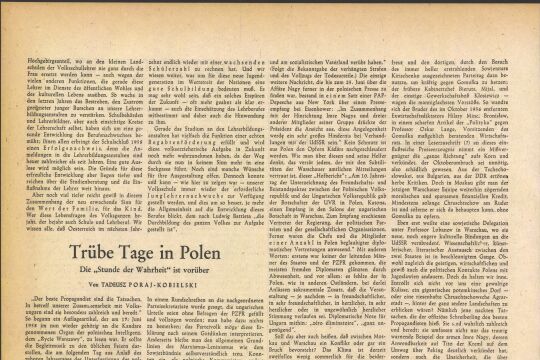Während die wirtschaftliche Öffnung von Laos in den Städten bescheidenen Wohlstand bringt, leben die Menschen auf dem Land in drückender Armut, die durch die Folgen des Vietnamkrieges noch verstärkt wird.
Es ist ein dunstiger Morgen in Thakhek, einer kleinen laotischen Stadt am Mekong. Die orangefarbenen Kutten der Mönche auf ihrer morgendlichen Sammeltour strahlen wie bewegliche Farbtupfer aus dem Hellgrau. Ansonsten tut sich nicht viel - der Ort scheint irgendwo zwischen Lethargie und verhaltenen Zukunftshoffnungen stecken geblieben zu sein. Die einst schmucken Kaufmannshäuser der ehemaligen französischen Kolonialherren verfallen pittoresk vor sich hin, der überdimensionierte Hotelklotz am Mekongufer wartet auf die angekündigte Verjüngungskur, und selbst an der staubigen Hauptstraße ist vom pulsierenden Leben anderer südostasiatischer Städte nichts zu spüren.
Bescheidener Reichtum
Dennoch ist die wirtschaftliche Öffnung dieses noch bis vor wenigen Jahren von der (westlichen) Welt abgeschlossenen kommunistischen Landes auch in Thakhek nicht zu übersehen: Wie in allen laotischen Mekongstädten sind die Häuser hier größer und solider gebaut als in den Orten fernab des großen Flusses, da und dort sieht man sogar protzige neue Villen im Thai-Stil. Der Handel mit dem reichen Nachbarn Thailand, dessen Lichter abends vom jenseitigen Ufer in die stille Stadt an der Flussgrenze herüberstrahlen, bringt zumindest einigen Leuten in dieser Region beträchtlichen Wohlstand.
Hütten statt Häuser
Als uns der Jeep der Hilfsorganisation CARE an diesem trüb-warmen Morgen auf der schlaglöchrigen Schotterpiste der Route Nummer zwölf Richtung Osten in die Nähe der vietnamesischen Grenze bringt, lernen wir ein anderes Laos kennen. In Wang Khon, drei mühsame Autostunden von Thakhek, gibt es - wie in den meisten laotischen Dörfern - keine Häuser aus Beton, keine Autos, keinen Strom, keine Wasserleitungen. Hier leben die Menschen in strohgedeckten Holz- oder Bambushütten auf Stelzen, ihr Badezimmer ist der nächste Fluss. Die wunderbare Landschaft mit ihrer üppigen Vegetation, den schroffen Felsen im Hintergrund und den unzähligen kleinen Teichen lässt die laotische Regierung davon träumen, diese Region irgendwann touristisch zu verwerten.
Doch das tropische Idyll abseits der Zivilisation hat tiefe Kratzer. Rundherum wird der kostbare Wald abgeholzt, das Geld dafür versickert in den Taschen hoher Regierungsbeamter und Militärs. Am nahen Theun-Fluss wird bald ein ökologisch höchst bedenklicher, 450 Quadratkilometer großer Staudamm entstehen, und auch die hübschen Teiche der Gegend haben eine wenig idyllische Geschichte: "Die vielen Fischteiche in dieser Gegend sind eine reine Notlösung", erzählt uns der 75-jährige Khamsone Pamiphomasene. "Wir haben sie aus den Bombentrichtern gemacht, die uns die Amerikaner zwischen 1964 und 1973 hinterlassen haben. Was wir aber viel dringender brauchen als Fischteiche sind Reisfelder!" Die aber wird es in Wang Khon vielleicht nie mehr geben, denn der Boden in dieser abgelegenen Region ist voll von Blindgängern, Minen und Bomben. Relikte eines offiziell nie erklärten Krieges gegen Laos, in dem die USA mehr als zwei Millionen Tonnen Bomben über dem kleinen südostasiatischen Land abwarfen - mehr als im gesamten Zweiten Weltkrieg.
Vor allem der Osten des Landes wurde systematisch zerbombt, da die Nordvietnamesen den Ho-Chi-Minh-Pfad, das komplexe Verbindungssystem zwischen Nord- und Südvietnam, während der Zeit des Vietnamkrieges immer weiter in laotisches Gebiet hinein ausdehnten. Rund ein Drittel dieser Abwürfe ist nicht explodiert. Noch heute ist Laos eines der durch Blindgänger am meisten bedrohten Länder der Welt. Das macht die Feldarbeit für die vielen Kleinbauern in diesem Gebiet bis heute zu einer lebensgefährlichen Angelegenheit.
Härter als vor dem Krieg
"Damals, als es jahrelang Bomben regnete, ist meine gesamte Familie mit allen anderen überlebenden Dorfbewohnern in eine weniger gefährliche Provinz geflüchtet", erzählt Khamsone. Er selbst habe von 1968 bis 1975 mit den Regierungstruppen in Höhlen gelebt. In sein Heimatdorf kam er erst Mitte der 80-er Jahre wieder zurück. "Heute", meint er, "ist das Leben hier noch härter als vor dem Krieg. Früher hatten wir zumindest genug zu essen, da wir ausreichend Reis anbauen konnten". Heute müssen die Familien von Wang Khon ihren Reis, das traditionelle Hauptnahrungsmittel der Laoten, mühsam an oft weit entfernten Berghängen pflanzen. Die Erträge sind so gering, dass zusätzlich Reis gekauft werden muss. Weil das Geld dafür selten reicht, haben die Menschen gelernt, mit dem Mangel zu leben.
Die Hoffnung auf bessere Anbauflächen ist gering, denn die Säuberung des Bodens von nicht explodierten Sprengkörpern ist eine teure und aufwändige Angelegenheit, deren Ende nicht absehbar ist. Und mit minenverseuchter Erde können auch die Bombentrichter nicht aufgefüllt werden.
Um den Hunger zu bekämpfen, müssen also Alternativen gefunden werden. "Wir unterstützen die Leute hier beispielsweise mit Saatgut für Gemüse oder bei der Rinder-, Büffel- und Schweinezucht", erklärt Ketmany Vongphasouk von CARE. Für die Arbeit an der Zufahrtsstraße zu ihrem Dorf haben sie von der Hilfsorganisation Lebensmittel bekommen. Für die Menschen von Wang Khon ist das zwar mehr als ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber dennoch zu wenig für ein Leben, in dem zumindest die Grundbedürfnisse befriedigt werden können. "Die meisten Familien hier können sich oft über mehrere Monate im Jahr nicht satt essen", berichtet Khamsone.
Bomben für 5 Cent pro Kilo
In ihrer Not durchwühlen viele Männer des Ortes tagtäglich die Erde auf der Suche nach den gefährlichen Relikten des Krieges - Altmetall, das sie für 700 Kip (etwa fünf Cent) pro Kilo verkaufen können. Die Warnungen der UXO, einer staatlichen Organisation, die mit internationaler Unterstützung die zahllosen nicht explodierten Sprengkörper im laotischen Boden aufspürt und entschärft, haben bei ihnen nicht gefruchtet. "Natürlich habe ich Angst um meinen Mann", meint eine junge Frau, "aber wir haben keine Wahl, wir brauchen das Geld." An die 20 Kilo Metall werden von den Männern jeden Tag aus der Erde gegraben, mehr als 200 Tonnen sind das seit 1975. Dass es seit damals keinen Unfall gegeben hat, kommt einem Wunder gleich. Aber das kann sich täglich ändern.
Was bleibt, ist eine mit vager Hoffnung durchsetzte Bitterkeit: "Wenn du Amerikanerin wärst", sagt mir Khamsone zum Abschied, "würde ich dich bitten zu schreiben, dass deine Regierung endlich die Bomben suchen sollte, die sie uns hier gelassen hat. Damit wir wieder unsere alten Reisfelder anlegen können".
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!