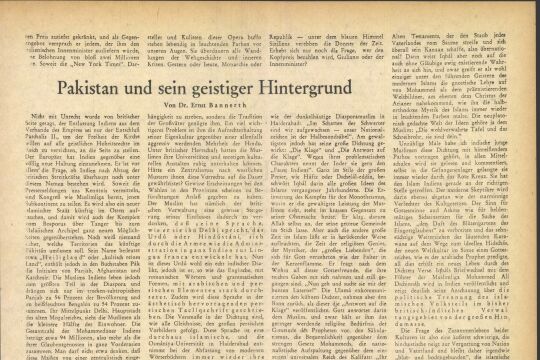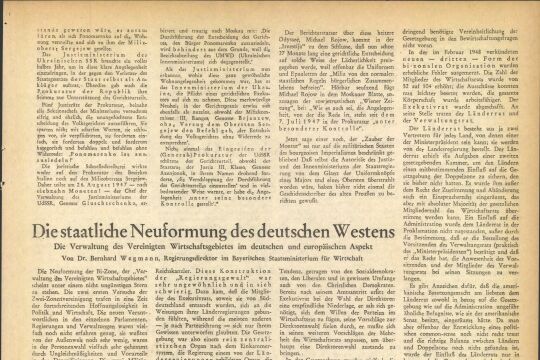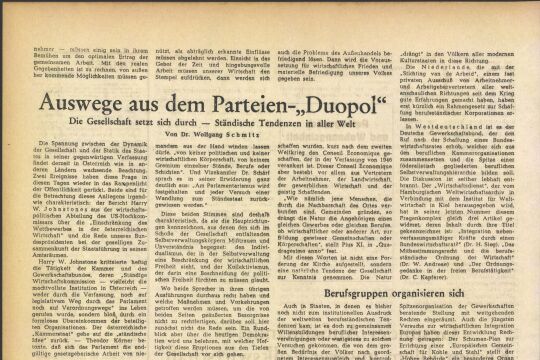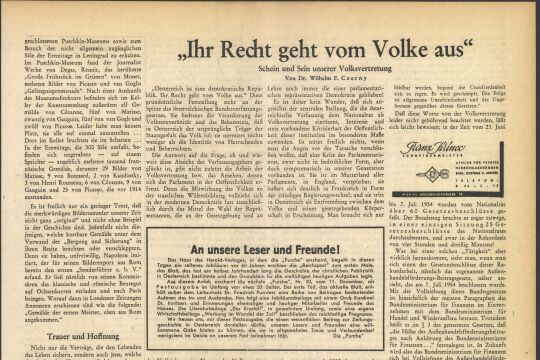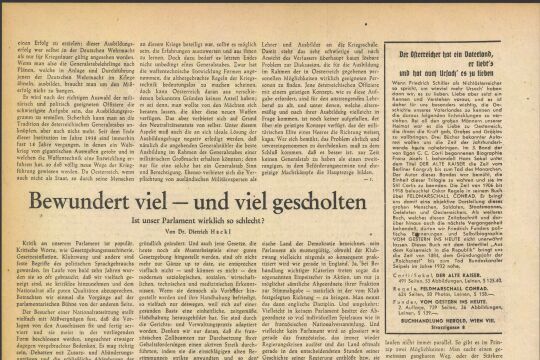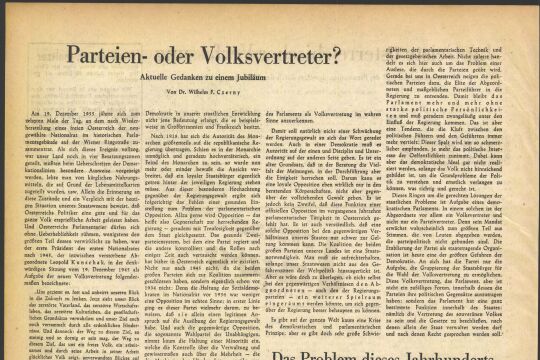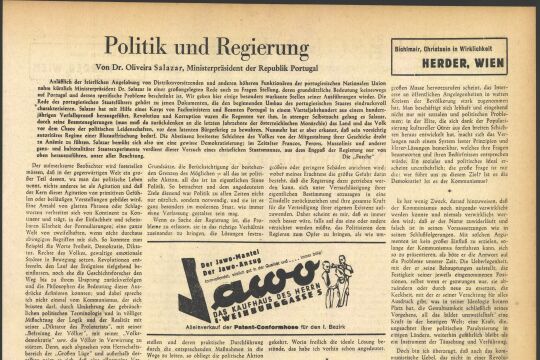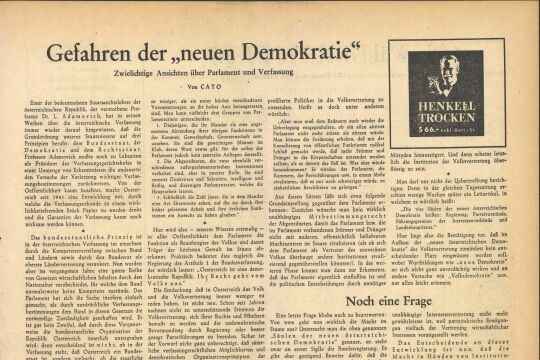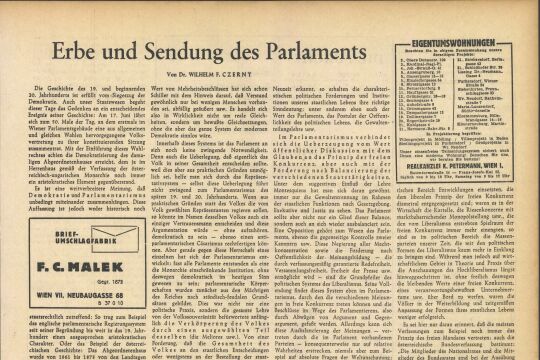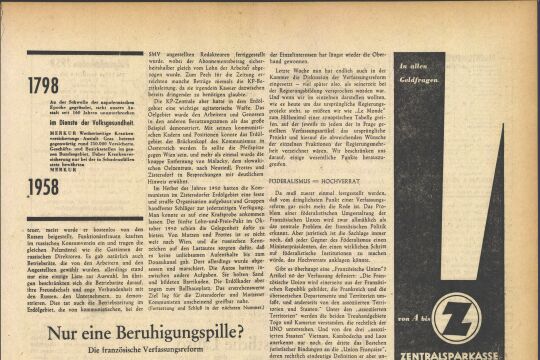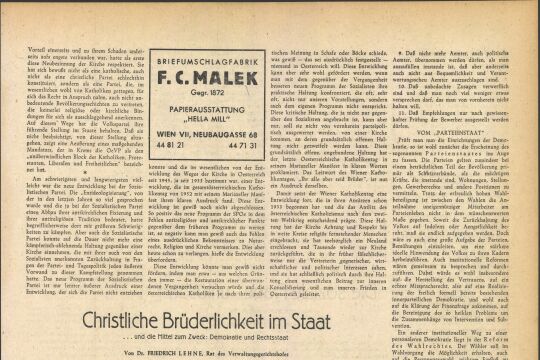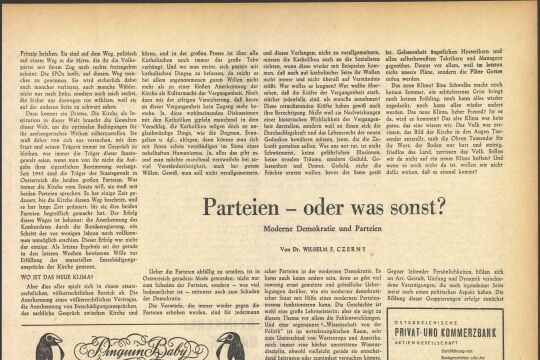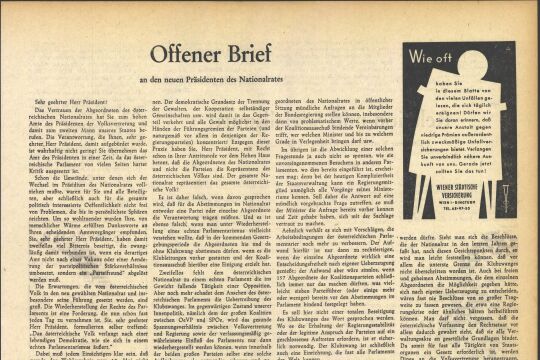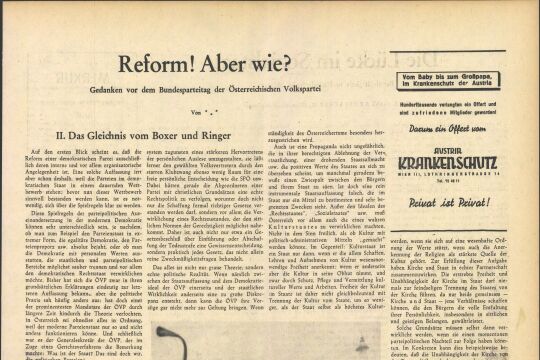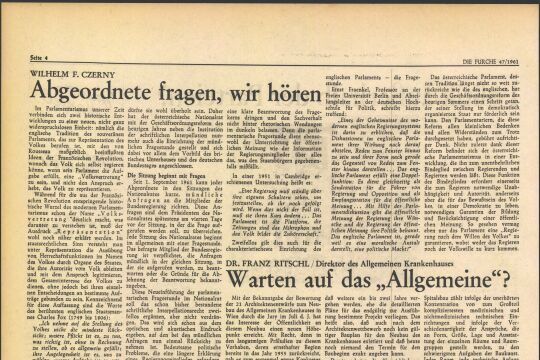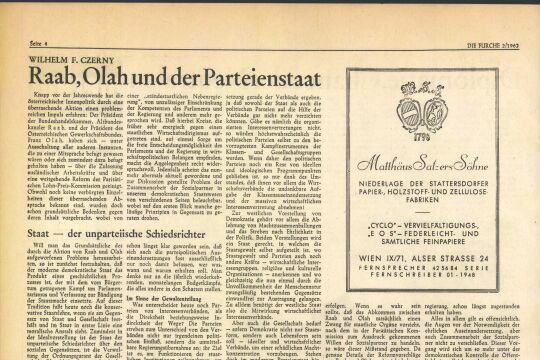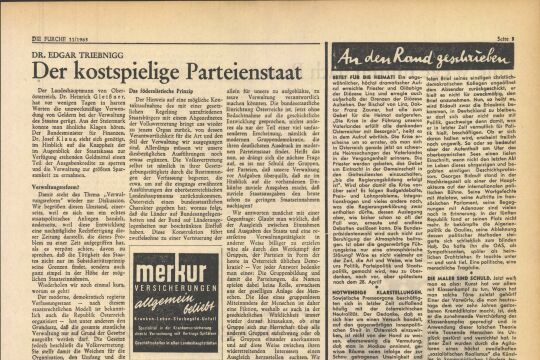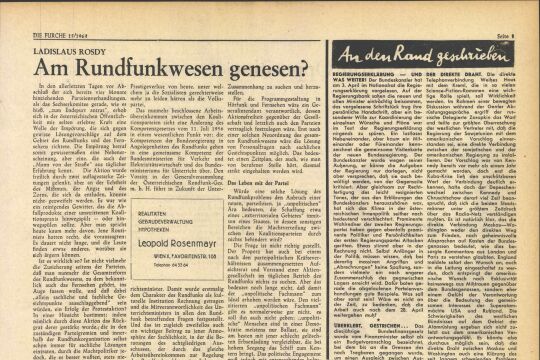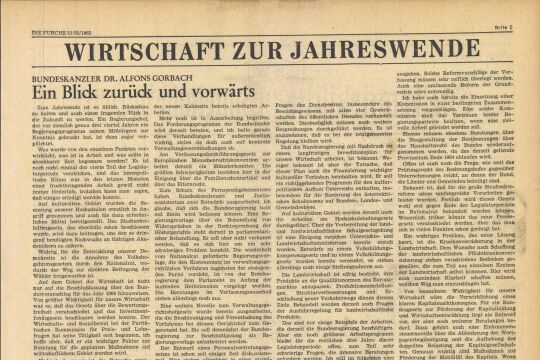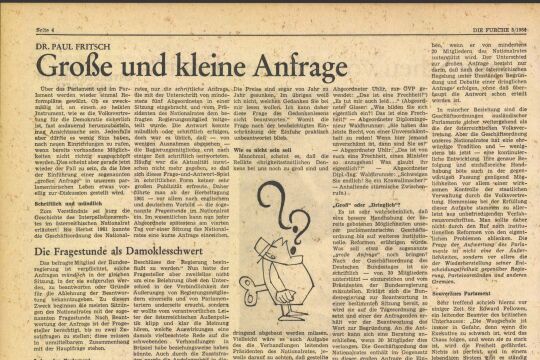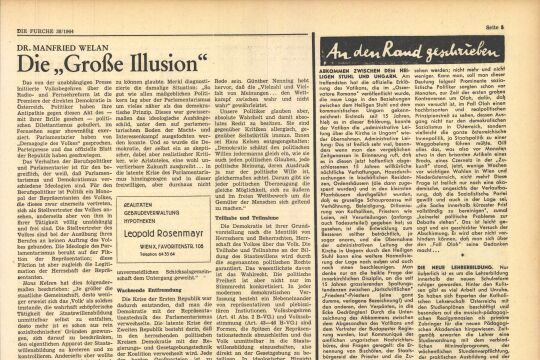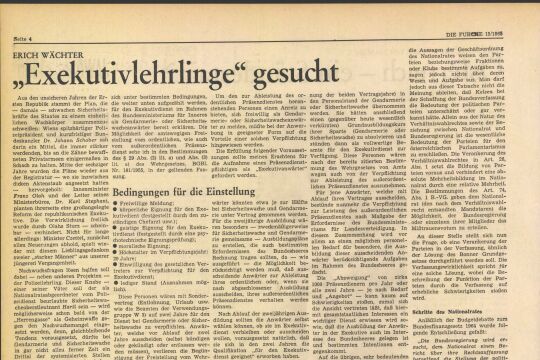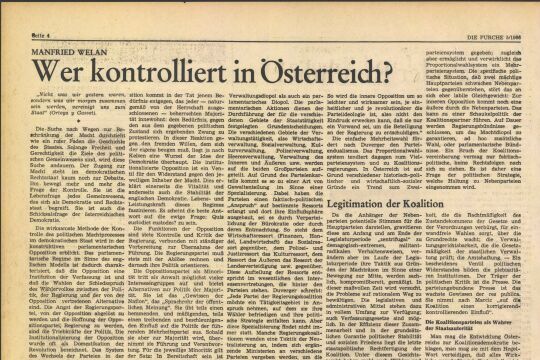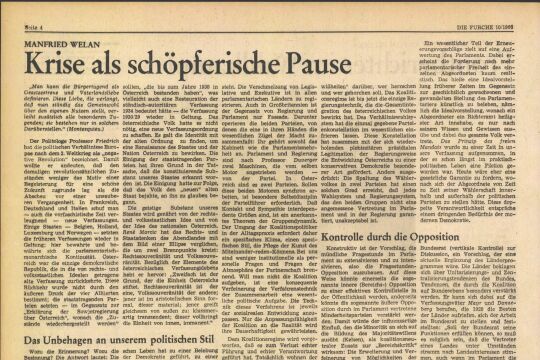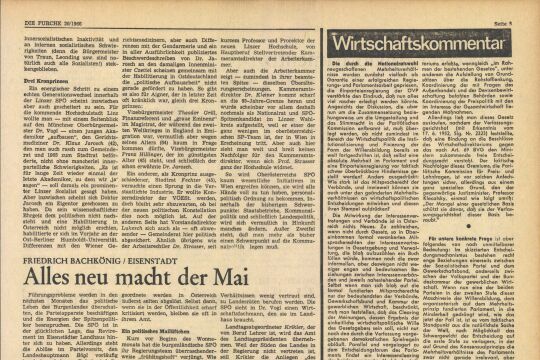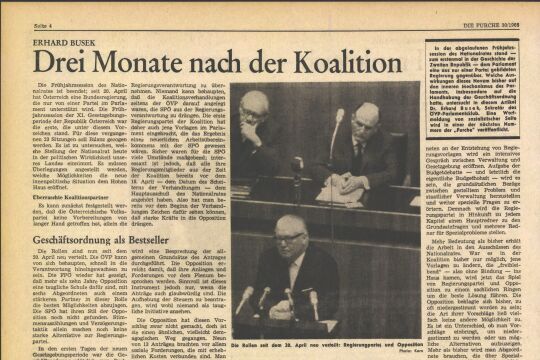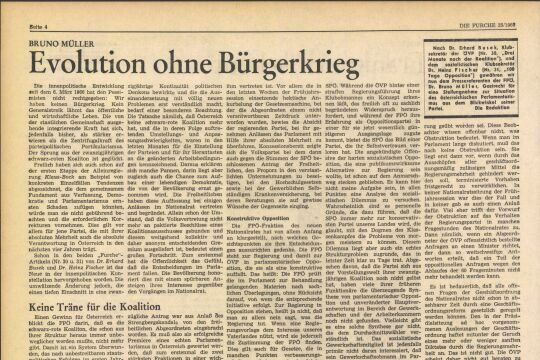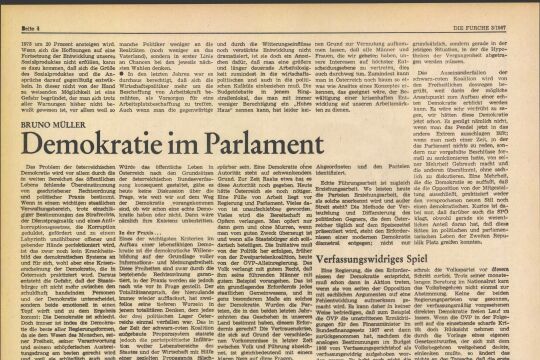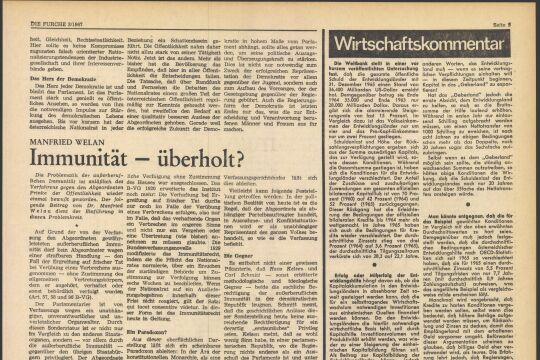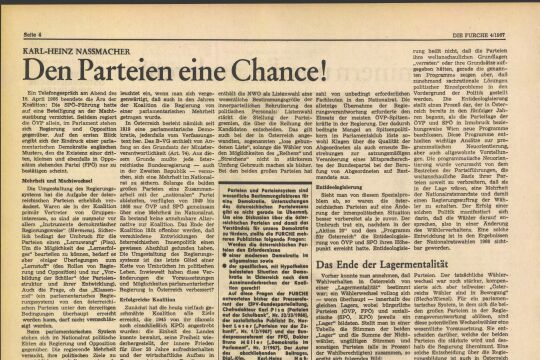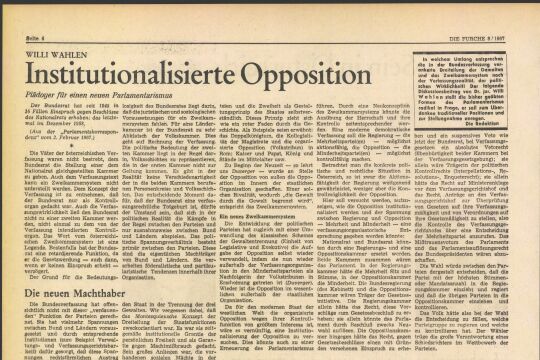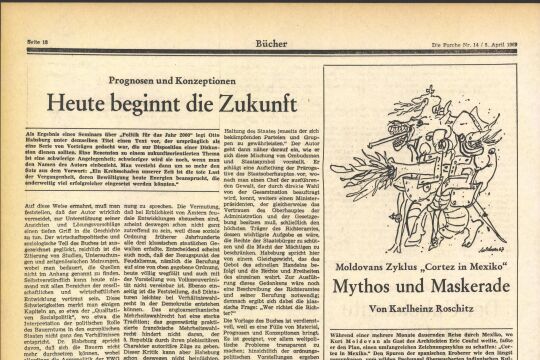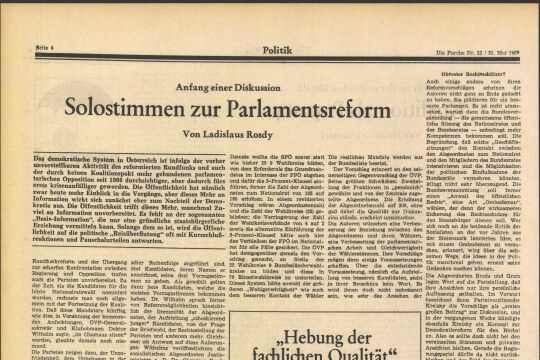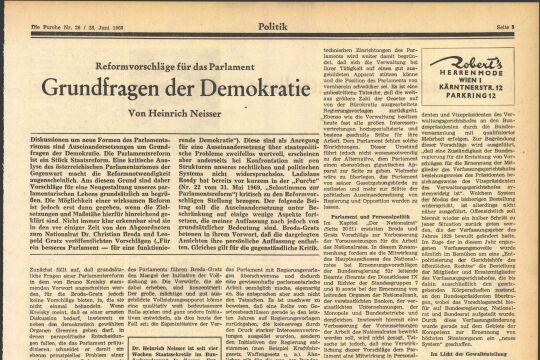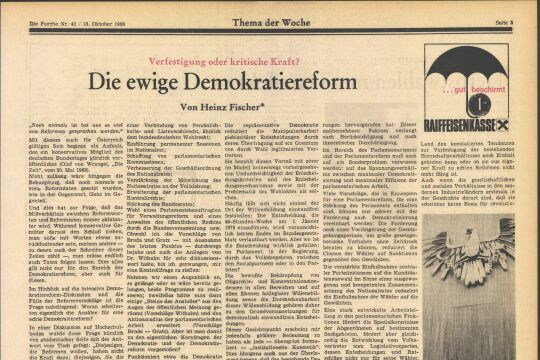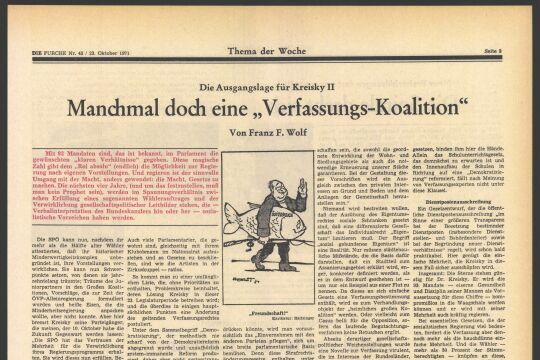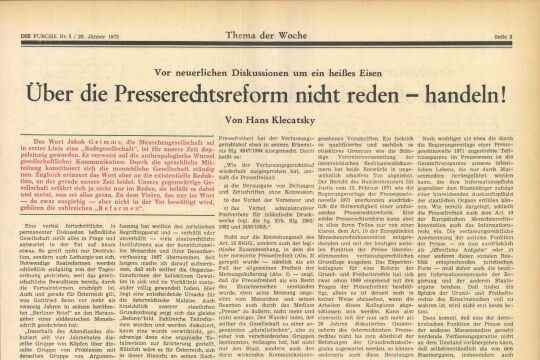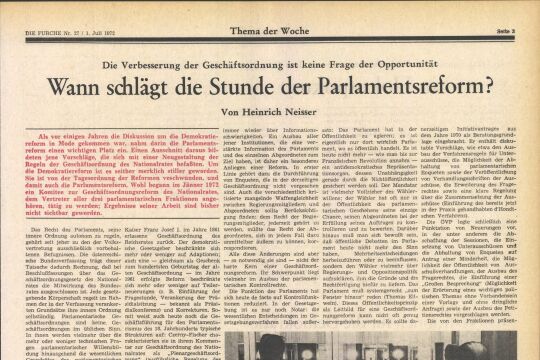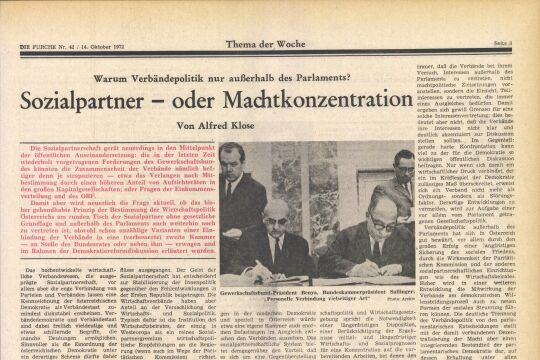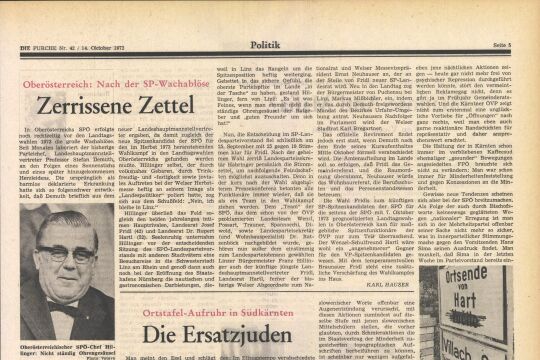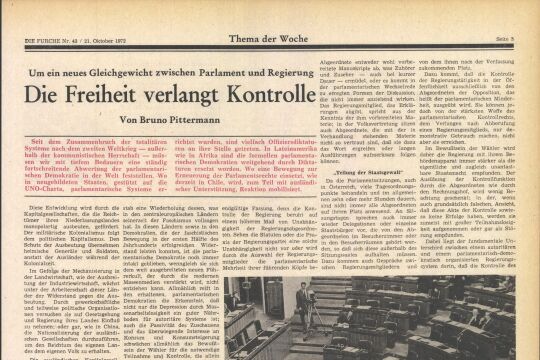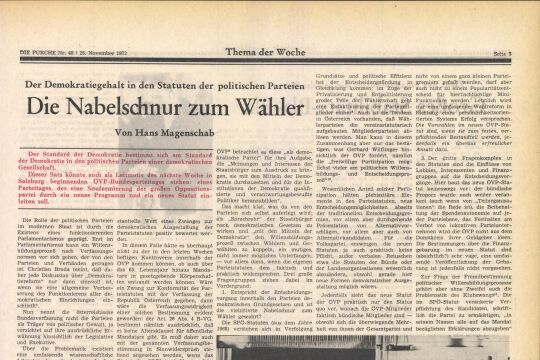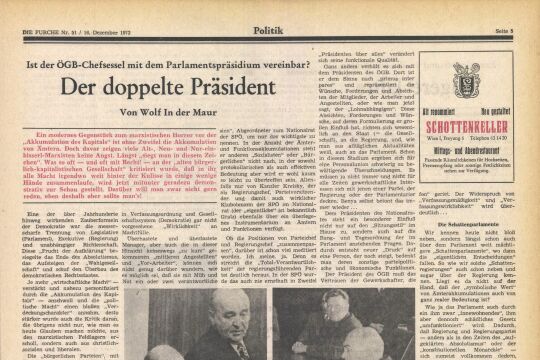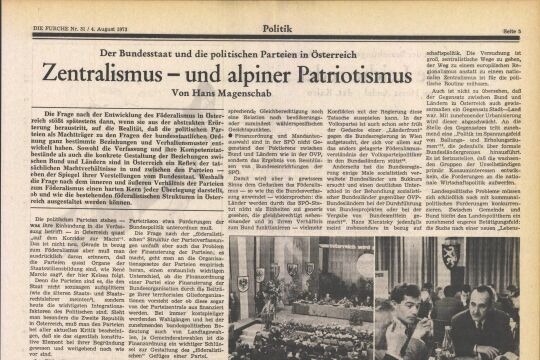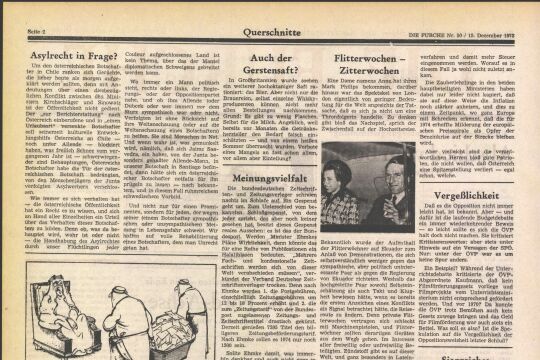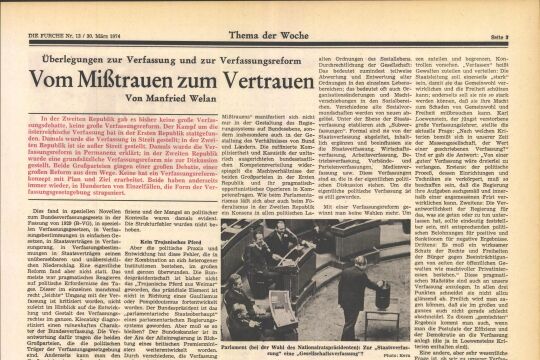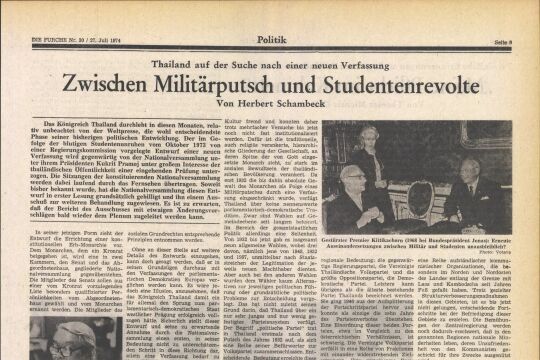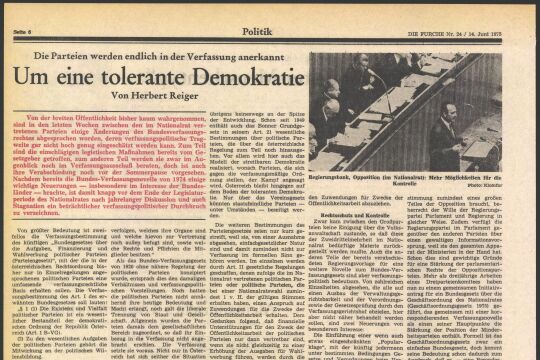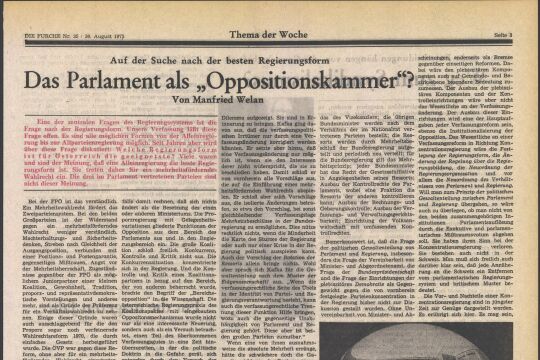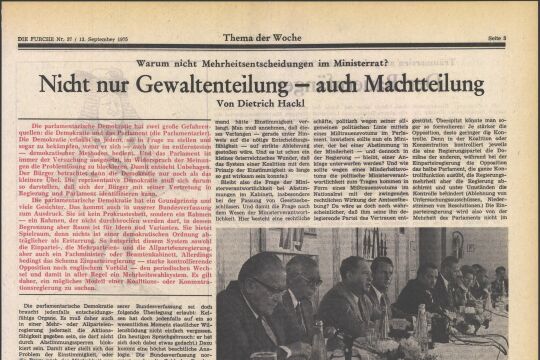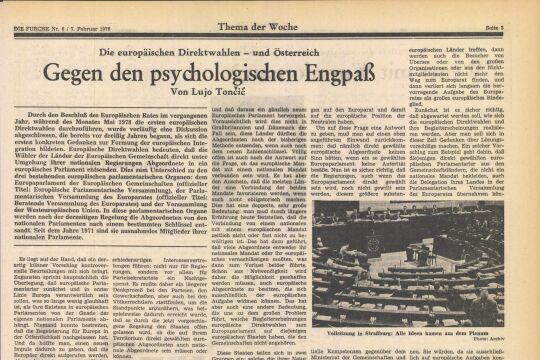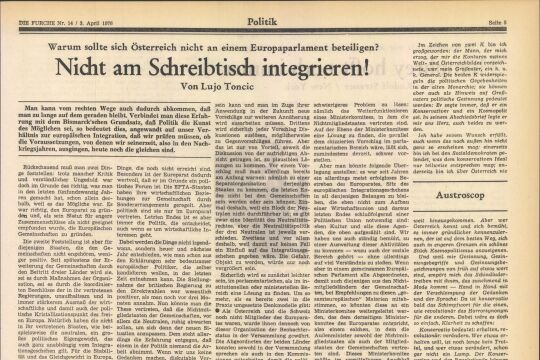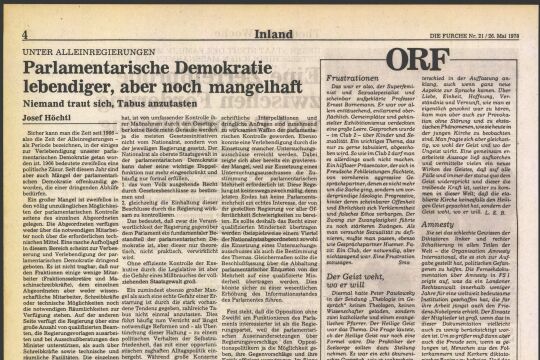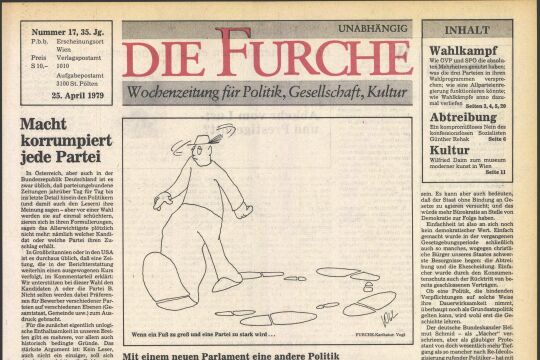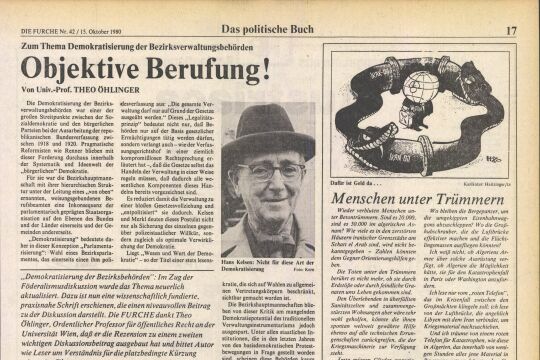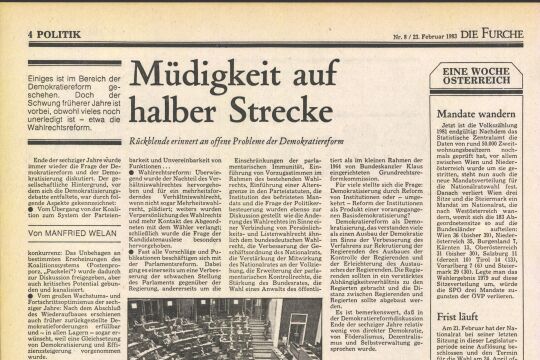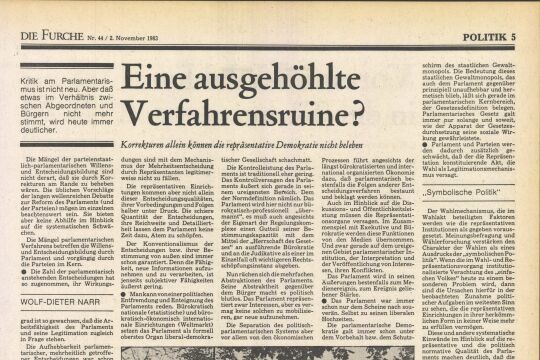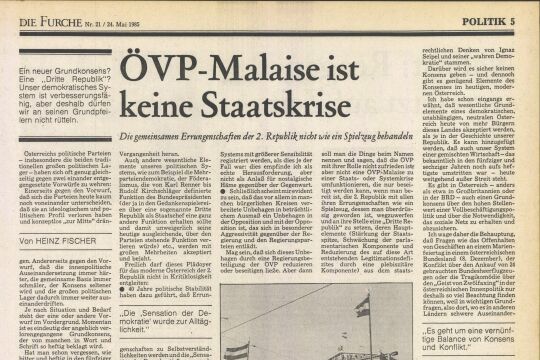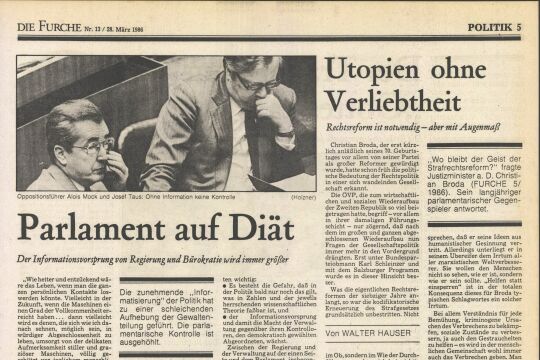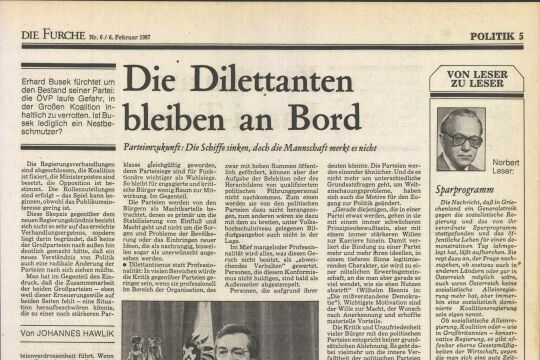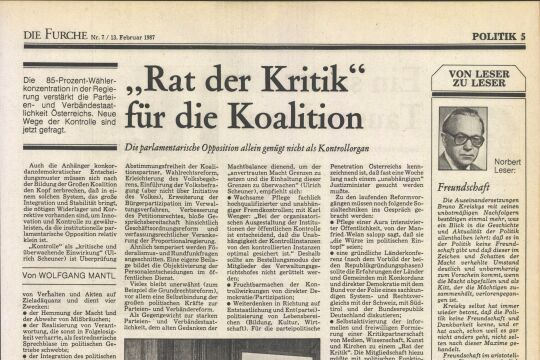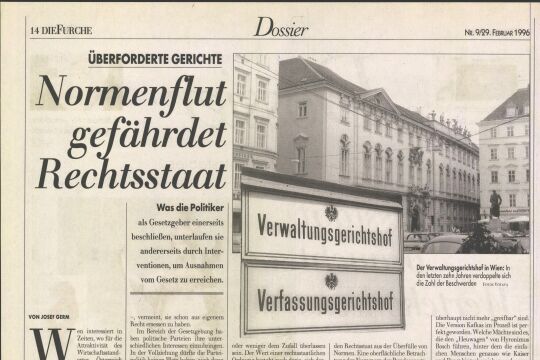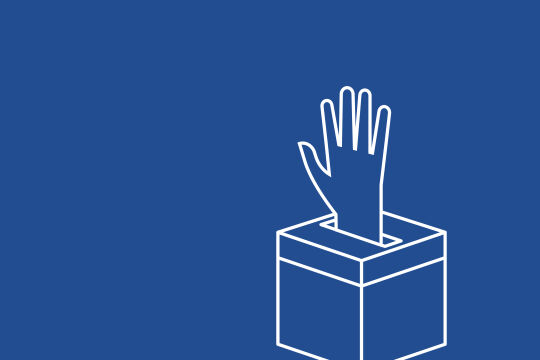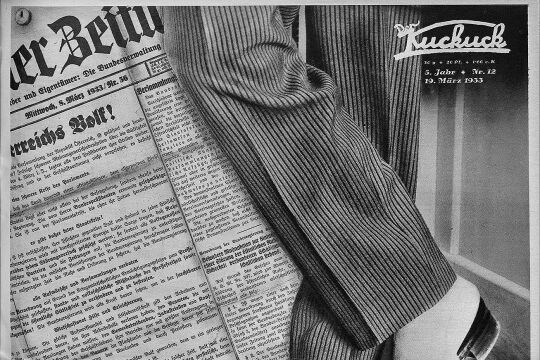Bau.Stelle Parlament
FOKUS
Das Parlament darf nicht zur Fassade werden
Der parlamentarische Aspekt des Regierungssystems stand in Österreich lange im Hintergrund und wurde auf Formalfunktionen reduziert. Die Erneuerung des Ideals setzt eine aktive Bürgerbeteiligung voraus.
Der parlamentarische Aspekt des Regierungssystems stand in Österreich lange im Hintergrund und wurde auf Formalfunktionen reduziert. Die Erneuerung des Ideals setzt eine aktive Bürgerbeteiligung voraus.
Die Bundesverfassung 1920 baut auf einer engen Verschränkung von Demokratie und Rechtsstaat, von Politik und Recht auf. Zugleich sieht sie – bis heute – vor, dass Konflikte innerhalb von Staatsorganen bzw. zwischen bestimmten Staatsorganen politisch gelöst werden müssen. Wenn sich nun aber (wie dies für die Erste Republik typisch war) das Parteiensystem durch eine hohe Polarisierung auszeichnet, dann wirkt dies unmittelbar auf den Parlamentarismus zurück. Er verfügt in einer solchen Situation über keine geeigneten Instrumente zur Konfliktlösung.
Eine kompromissorientierte Parlamentarismus und Demokratietheorie, wie sie der Jurist Hans Kelsen in dieser Zeit entwickelt hat, hat unter diesen Bedingungen keine Chance auf Umsetzung oder wird auf ihren instrumentellen Kern reduziert. Die Antwort darauf war in der Zweiten Republik, die Konflikte auf einer anderen Ebene und nicht im öffentlichen Parlamentsstreit zu lösen. Der parlamentarische Aspekt des Regierungssystems wurde damit lange in den Hintergrund gedrängt und auf Formalfunktionen reduziert. Dies hatte auch zur Folge, dass in Österreich (im Unterschied zu anderen westeuropäischen Staaten und vor allem zur Bundesrepublik Deutschland) zwar eine intensive Auseinandersetzung mit politischen Parteien und der Sozialpartnerschaft stattgefunden hat, aber eine vergleichbare Diskussionsgrundlage für Bewertung und Perspektiven des Parlamentarismus weitgehend fehlt.
Die Erfahrung zeigt aber auch, dass wir Regeln in den seltensten Fällen „nach Punkt und Beistrich“ anwenden (können). Es ist immer wieder erforderlich, die konkreten Umstände zu berücksichtigen, Menschen bilden Routinen aus, schaffen neue Regeln oder Konventionen, nach denen sie andere Regeln anwenden. Der Preis dafür kann jedoch eine Erstarrung der Abläufe sein, da Änderungen in der Regel auf hohe Zustimmung angewiesen sind.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!