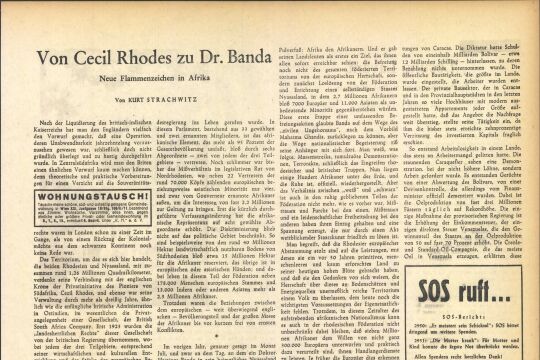Im zweiten Anlauf haben die Venezolaner ihrem Präsidenten Hugo Chávez die unbegrenzte Wiederwahl erlaubt. Ein Fehler, sagen linke Demokraten, durch den der einst offene Sozialismus Venezuelas verarme.
Hugo Chávez kommt nicht mehr aus dem Feiern raus: Vor wenigen Wochen zelebrierte der 54-jährige venezolanische Staatschef mit viel Pomp sein zehnjähriges Amtsjubiläum. Am vergangene Sonntag hat er nun ein Verfassungsreferendum mit 54 Prozent der Stimmen in seinem Sinne entscheiden können: Damit sind dem Präsidenten und anderen gewählten Volksvertretern beliebig viele Amtszeiten erlaubt. Bei einem Volksentscheid im Dezember 2007 hatte es noch keine Mehrheit für die Möglichkeit einer unbegrenzten Wiederwahl des Präsidenten gegeben. Doch nach dem Erfolg vom Sonntag gibt sich Chávez zuversichtlich: „Wenn Gott will und mir Gesundheit gibt, bleibe ich bis 2019, bis 2021 für euch da.“
Mit seinem „Sozialismus des 21. Jahrhunderts“ spaltet der Ex-Offizier die Geister. Das Erfolgsrezept des linken Charismatikers ist seine mediale Omnipräsenz. In seiner berühmt-berüchtigten wöchentlichen Fernsehsendung „Alo presidente“ inszeniert er sich als Held der Armen, kann sich aber auch stundenlang über die Frage auslassen, ob es Leben auf dem Mars gibt. Beim Großteil der Venezolaner kommt der Sohn eines Dorfschullehrers mit seiner unverblümten Art und seiner fluchenden Polemik jedenfalls gut an.
In Simon Bolivars Fußstapfen
Wobei ihm bei den Regionalwahlen vor drei Monaten, die Chávez selbst zur „Feuerprobe“ erklärt hatte, ein wenig der politische Bart gestutzt wurde. Seine Vereinte Sozialistische Partei (PSUV) setzte sich zwar in 17 von 22 Gouverneursämtern durch, doch die Oppositionskandidaten siegten in drei der vier größten Regionen des Landes. Zudem bringt ihn auch der Verfall des Ölpreises mehr und mehr in Bedrängnis.
Doch Chávez ist ein Stehaufmännchen: 2002 überstand er einen Militärputsch und einen zweimonatigen Generalstreik. 2006 wurde er mit einer Mehrheit von 62 Prozent der Stimmen wiedergewählt. Chávez versprach eine friedliche Revolution zum Wiederaufbau Venezuelas: Schluss mit der Korruption, weg mit den verkrusteten Parteistrukturen, weniger Abhängigkeit vom Erdöl und Wiederbelebung der Ideale des Freiheitshelden Simon Bolivar. Die sprudelnden Öleinnahmen nutzte er für die Verstaatlichung von Unternehmen und für Sozialprogramme wie Hilfen für alleinerziehende Mütter, Alphabetisierung und kostenlose Kliniken. Zehn Jahre später sei von diesen Zielen, sagen Kritiker, nicht viel übrig geblieben: „Was 1998 als Projekt des sozialen Wandels begann, beschränkt sich mittlerweile auf einen Vorschlag: die unbegrenzte Wiederwahl“, meint der Chávez-Biograf Alberto B. Tyszka.
Die Chávez-Regierung habe ihm nichts gebracht, sagt auch der Kleinwarenhändler Mateo Canache in einem Korrespondentenbericht: keine Kredite für Saatgut, keine kostenlose Gesundheitsversorgung, keine subventionierten Lebensmittel. „Die Revolution funktioniert hier nicht“, sagt Canache, der in den slumähnlichen Außenbezirken von Caracas ein Geschäft betreibt.
Trotzdem hat er bei der Volksabstimmung am Sonntag erneut Chávez unterstützt. Warum? Er beobachtet, erklärt Canache, wie für andere etwas von den Wohltaten abfällt, und sieht im Fernsehen, wie Chávez Hilfen an Landarbeiter verteilt. Er sagt, Chávez sei der erste Präsident, dem er vertraue, der erste, der Leuten wie ihm offenbar wirklich helfen wolle, er sei „unsere Hoffnung, unsere Zukunft“.
Auch Statistiken bescheinigen der Chávez-Politik eine Verbesserung der Lebensqualität: Die Arbeitslosigkeit ist zurückgegangen, der Schulbesuch hat zugenommen und der Anteil der Armen ist von 44 Prozent der Haushalte 1998 auf etwa 30 Prozent zurückgegangen. „Vor 1999 hatten wir eine De-facto-Apartheid. Die Armen wurden auch politisch und kulturell ausgeschlossen. Das Leben von zig Millionen Armen wurde mit Chávez von heute auf morgen ganz anders“, sagt Edgardo Lander, Professor für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften in Caracas und früherer Regierungsberater.
In Richtung Sowjet-Sozialismus
Lander beklagte gegenüber der FURCHE jedoch die Wende des Präsidenten zu einem überwunden geglaubten Sozialismus. Die unbegrenzte Wiederwahl oder der Weg Richtung Einheitspartei ähneln für ihn allzu sehr dem alten, real existierenden Sozialismus. Für den linken Soziologen war der venezolanische Sozialismus einmal „offen für Experimente, für Vielfalt, er hat seine Wurzeln in der Geschichte Lateinamerikas, bei Bolívar, im Urchristentum, in den Kämpfen der indigenen Völker …“ Heute sieht er den Chávez-Weg der Vereinheitlichung als eine „außerordentliche Verarmung des demokratischen Prozesses“.
Lander bedauert zudem, dass niemand mehr in der Regierung „eine politische Geschichte vor Chávez hat“ und dass jene renommierten Leute, die dem Präsidenten etwas entgegensetzen konnten, weg sind: „Das ist schädlich und trägt dazu bei, dass es keine Debatte gibt!“
Zum Beispiel über die Nachhaltigkeit eines Wirtschaftssystems, das am Erdöltropf hängt. „Wir sind ein Erdölland geblieben – bei jedem Boom drehen die Leute durch“, sagt Margarita López Maya, Sozialhistorikerin, Kolumnistin und eine wichtige Linksintellektuelle Venezuelas. „Die Inflation steigt, es wird nicht produziert. Das sind die Schwächen, die Venezuela immer geprägt haben, unabhängig von Revolution, Diktatur oder Demokratie. Anscheinend sind die Regierungen nicht in der Lage, das Öl zu zähmen.“
Und wird sich Chávez zähmen lassen? „Sehr tolerant war er noch nie“, sagt López, „auch innerhalb des Chávismo gibt es große Widerstände gegen diese autoritären Tendenzen.“ Chávez gibt sich nach seinem Erfolg jedenfalls bescheiden: Der Respekt vor den Institutionen sei eine goldene Regel der Demokratie und es sei wie im Fußball: „Wenn der Schiedsrichter einen Elfmeter pfeift, ist es ein Elfmeter. Wenn er sagt, das Spiel ist vorbei, ist es vorbei.“e