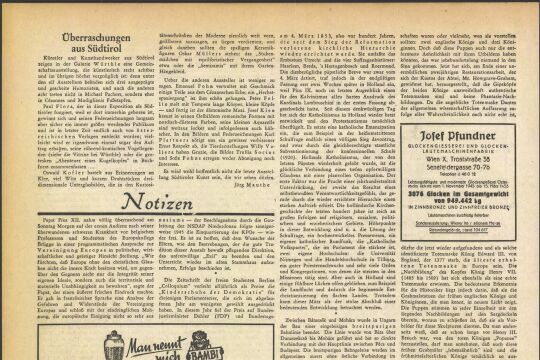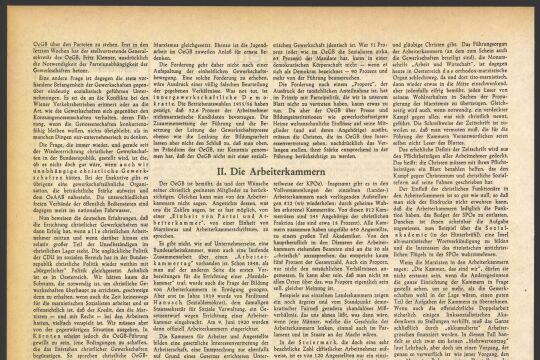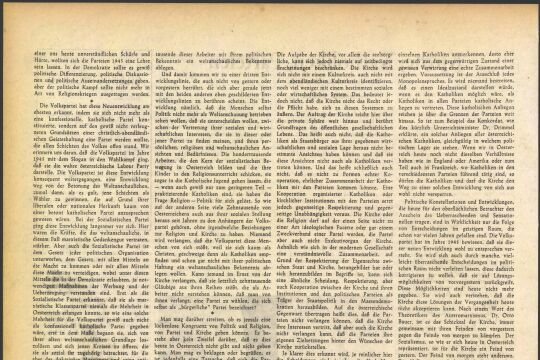Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Demokratische Miliz
Mit großer Aufmerksamkeit verfolgt die Öffentlichkeit die Beratungen in Moskau, bei denen bisher auch in den militärischen Fragen eine Einigung leider noch nicht erzielt worden ist. Aber eines steht doch schon fest: Österreich erhält eine Wehrmacht von 53.000 Mann. Dieses kann schon aus finanziellen Gründen kein Söldnerheer sein — vermochte doch deshalb die wirtschaftlich ungleich günstige gestellte Erste Republik, den in St.-Germain zugestandenen Stand von 30.000 Mann solange nicht erreichen, bis die allgemeine Wehrpflicht eingeführt wurde. Ganz abgesehen von vielen anderen Gründen, die gegen ein Berufsheer sprechen. Bekanntlich ist keinem Satellitenstaate in dem vor einigen Wochen unterzeichneten Friedensvertrage ein Söldnerheer auferlegt worden; alle haben ihrem künftigen Heere die allgemeine Wehrpflicht zugrunde gelegt.
Zweierlei Wehrsysteme beruhen auf der allgemeinen Wehrpflicht: das Kadersystem, mit einem starken Rahmen von Berufsoffizieren und Berufsunteroffizieren, der alljährlich durch den nächsten zum Militärdienst herangezogenen Jahrgang junger Männer auf den vorgeschriebenen Stand aufgefüllt wird, und das Milizsystem. Uber das letzter* scheinen weite Kreis der Öffentlichkeit weniger unterrichtet zu sein, sonst würde in Zeitungen verschiedener Parteien nicht wiederholt eine „demokratische Miliz“ gefordert werden.
Von allen Staaten Europas hat einzig und allein nur die neutrale Schweiz ihr Heerwesen auf dem Milizsystem aufgebaut, alle übrigen Staaten verfügen über Kaderheere, wobei allerdings die Dienstzeit in den Heeren der skandinavischen Staaten und der Niederlande bis zum zweiten Weltkrieg nicht viel länger dauerte als im Milizheer der Schweiz. Seither wurde auch in diesen Staaten die Dienstzeit wesentlich verlängert, zum Beispiel in Schweden auf ein Jahr.
Charakteristisch für das Milizsystem ist aber keineswegs die kurze Dienstzeit, sondern das Fehlen eines starken Kaders. Vor Ausbruch des zweiten Weltkrieges waren in der Schweiz nur der Chef-und die Abteilungschefs des Generalstabes, die Waffen-diefs und die Korps- und Divisionskommandanten Berufsoffiziere, alle übrigen Offiziere, bis zum Range eines Brigadekommandanten hinauf, waren Milizoffiziere, die nur zu Übungen einberufen wurden und im übrigen ihren Zivilberuf ausübten. Überdies gab es etwa 300 „Instruktionsoffiziere“. Dieses Bild hat sich während der sechsjährigen Mobilisierung, 1939 bis 1945, allerdings geändert; bei Kriegsende wurden die Mehrzahl der Heereseinheiten und alle Schieß-, Offiziers- und Rekrutenschulen von Berufsoffizieren befehligt, die überdies fast alle Stabschefposten innehatten. Gibt das nicht zu denken? Verfügt Österreich über genug Nicht-berufsoffiziere zur Aufstellung einer Miliz? Ware es zweckmäßig, an ihrer Stelle das Gros der vorhandenen Berufsoffiziere zu pensionieren? Diese leicht zu beantwortenden Fragen zeigen, daß die Verfechter des Milizsystems nicht wissen, was sie eigentlich fordern, sondern offenbar unter „Miliz“ ein Kaderheer mit sehr kurzer Dienstzeit verstehen.
Die Dauer der Dienstzeit hängt nicht nur davon ab, wie lange man zur vollständigen Ausbildung eines Rekruten braucht. Wenn unser künftiges Heer eine Stärke von 53.000 Mann aufweisen soll, so wären bei nur halbjähriger Dienstzeit — wie sie mehrfach vorgeschlagen wird — alljährlich 106.000 Mann auszuheben. Nun zählten die Geburtsjahrgänge 1927 bis 1936 — auf die es ja im Laufe der nächsten zehn Jahre ankommt — Ende 1935 nur 57.874 (1927) bis 34.581 (1936) Männer; wieviel von ihnen sind seither verstorben? Und wie viele von den Verbliebenen sind nach den adit Hungerjahren militärdiensttauglich? Diese dürftigen Ziffern zeigen, daß zur Aufrechterhaltung des Standes von 53.000 Mann nicht einmal die injährige Dienstzeit ausreicht.
Nun zur Frage der „Demokratisierung“ des künftigen Heeres!
Da wird vor allem geforden, daß die Offizierslaufbahn allen Schichten der Bevölkerung zugänglich sei. Das war sie bekanntlich sowohl in der alten k. u. k. Armee als auch im Bundesheer, wenn auch nicht verschwiegen werden soll, daß bei der k. u. k. Kavallerie vor allem Söhne aus begüterten Familien gedient .haben; die geringen Bezüge der jungen Offiziere reichten eben nicht zur Bestreitung der Pferdchaltung hin, für die der Staat nicht aufkam. Wie demokratisch das Offizierskorps eingestellt war, mag ein Erlebnis aus meiner Leutnantszeit — zehn Jahre vor dam ersten Weltkrieg — dartun. Ein junger Kamerad, Sohn eines mährischen Schuhmachers, hatte seinen verstorbenen Vater in Zivilkleidung zu Grabe geleitet. Da das Tragen von Zivilkleidung verboten war, hatte er sich nach seiner Rückkehr beim Regimentsrapport zu verantworten. Er entschuldigte sich damit, daß er „sich des Berufes seines Vaters geschämt habe“. Diese undemokratische Äußerung bewog den Obersten einen Offizierssohn — den Fall dem ehrenrätlichen Ausschuß zu überweisen, dessen Mitglied ich war. Dieser bestrafte den jungen Offizier, weil „die Begründung seines Verhältens die Standesehre des Offiziers gefährdet habe“. Daß im Bundesheer bei der Auswahl des Offiziersnachwuchses der Beruf des Vaters keine Rolle gespielt hat, kann ich als seinerzeitiger Referent hiefür ebenso bestätigen wie die damaligen „Zivilkommissäre“ im Heeresministerium, die sich hiefür stets besonders interessiert haben.
Die demokratische Schweiz hat im Juli 1946 eine Statistik veröffentlicht, in der auch der Beruf des Vaters von 451 Offiziersanwärtern des Jahres 1945 angeführt ist:
Akademische Berufe 7 Prozent, Lehrer 8.5 Prozent, technische Berufe 5 Prozent, kaufmänische Berufe 23.5 Prozent, Beamte und staatlidie Angestellte 22 Prozent, freie und künstlerische Berufe 4 Prozent, Handwerker und Gewerbetreibende 19 Prozent, selbständige Landwirte 6 Prozent, Arbeiter und Hilfsberufe 5 Prozent.
(Interessanter als diese Zahlen ist die Tatsache, daß die Schweiz den Beruf der Väter der Offiziersanwärter so sorgfältig registriert und veröffentlicht und was hiezu die „Allgemeine Schweizerische Militärzeitung“ bemerkt: „Allgemeine Bildung, Herzensbildung^ Weitblick beruht vor allem auf den Einfluß des Elternhauses und des Milieus, in welchem der junge Mann aufgewachsen ist.“)
Eine weitere Forderung der Demokrat! geht unter dem Schlagwort „Freie Bahn dem Tüchtigen!“ Nicht die Vorbildung, sondern die praktische Eignung solle maft-gebend für die Ergänzung des Offizierskorps sein. Diese Forderung wurde auch bei der Aufstellung des Bundesheeres 1920 mit Nachdruck erhoben, aber es hat sich bald gezeigt, daß die, ohne Rücksicht auf ihre Vorbildung ernannten „Volkswehrleutnants“ den Anforderungen, die insbesondere die Erziehung der während des ersten Weltkriege vielfach ohne Einfluß des Vaters aufgewachsenen Wehrmäner und die moderne Technik, m ie stellte, nur zum Teil gewachsen waren, obwohl sie in der „Heeresschule“ durch mehrere Jahre geschult wurden. Auf Grund dieser Erfahrung wurden dann zwei Offizierskategorien geschaffen: wer für höhere Stellen in Betracht kam, hatte Mittelschulbildung nachzuweisen, ein Jahr bei der Truppe zu dienen und dann die dreijährige Militärakademie zu absolvieren. Anwärter mit geringerer Vorbildung konnten es nach Absol-vierung der zweijährigen Offiziersschule nof bis zum Hauptmann bringen. Die erfreulidi große Anzahl von Bewerbern ermöglichte ein strenge Auswahl, sowohl charakterlich al auch durch Auswahlprüfungen, die eine naturgemäß verschiedene Beurteilung in den Schulzeugnissen durch den Nachweis der wirklich vorhandenen Kenntnisse vereinheitlichten. Derartige Prüfungen werden in den nächsten Jahren besonders notwendig sein, da bekanntlich in der Hitlerzeit das Niveau der Schulen gelitten hat und Schulzeugnisse nicht immer nur auf Grund der nachgewiesenen Kenntnisse ausgestellt wurden. Der Forderung „Freie Bahn dem Tüchtigen“ wäre aber dadurch Rechnung zu tragen, daß auch Bewerber zur Offizierslaufbahn zugelassen werden, welche die notwendigen Kenntnisse nicht durch Schulzeugnisse, sondern durch eine Prüfung nachweisen, ähnlich der „Intelligenzprüfung“ der seinerzeitigen Ein-jährigfreiwilligen-Anwärter.
Forderungen im Namen der Demokratie richten sich auf die Veränderung der Stellung des Offiziers, wie zum Beispiel Aufhebung der Ehrengerichtsbarkeit, die aber beispielsweise von Generalissimus Stalin im Juli 1946 in der Sowjetarmee eingeführt wurde, oder auf die Abschaffung der Grußpflicht (die sowohl in der Schweiz wie irr Rußland besteht) und jeglichen .Brills“. Wie weit hierüber die Ansichten auch in der gewiß demokratischen Schweiz auseinandergehen, zeigen Äußerungen der dortigen Presse zum Thema „Demokratisierung der Armee“. Einerseits wird an die Stellungnahme des Generalstabschefs Sprecher von Bernegg erinnert: „Das moderne Heerwesen, auch das schweizerische, ist eine Anstalt, die mit irgendwelchen demokratischen Ideen nichts zu schaffen hat.“ Andererseits hat der Präsident der Schweizerischen Offiziersgesellschaft, Oberst Holliger, scharf gegen den Drill Stellung genommen und erklärt „Gewehrgriff und Taktschritt sind überfällig“.
Wenn die Verfechter einer Demokratisierung des Heeres darunter das zeitgemäße Verhältnis zwischen Vorgesetzten und Untergebenen sowie eine Modernisierung des Kasernenlebens verstehen, so wird ihnen jeder Soldat zustimmen. Wenn sie aber damit eine Hereinziehung des Heeres in die Parteipolitik, einer Lockerung der Disziplin und des Vertrauens zwischen Vorgesetzten und Mannschaft das Wort reden, untergraben sie die Grundlagen des neuen Heeres, dessen Aufbau ohnehin unerhört schwierig ist.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!