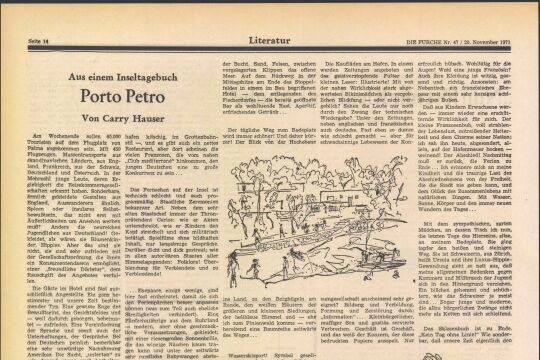Wer wissen will, wie die böse Variante der Finanzwirtschaft funktioniert, sollte sich "Der große Crash“ von J.C. Chandor ansehen. Ein großartiges| Schauspieler-Ensemble versucht sich an den Grenzen der Moral. Die Wirklichkeit kann es zwar noch schlimmer - aber weniger unterhaltsam.
In den guten alten 70er-Jahren gab es eine Comic-Serie mit dem Titel "Gespenster-Geschichten“. Der Satz am Ende jeder dieser Tausenden gezeichneten Grusel-Geschichten lautete: "Seltsam, aber so steht es geschrieben.“ So ist das auch mit der Krise: Es gibt Dinge, die gibt’s nicht.
Stellen Sie sich vor, Sie sind Müllverkäufer und wollen Müll verkaufen. Sie hängen dem Sackerl Unrat die Aufschrift "Gold!“ um und rufen ein paar Kunden an. Sie sagen ihnen, dass Ihr Boss heute befohlen habe, die Goldsackerl billigst zu verkaufen - auch um den Preis von Millionenverlusten. Ihre Bekannten werden nicht stutzig, sie fragen nicht nach, "Was willst Du mir da andrehen?“, oder "So etwas glaub ich nicht mal meiner Omi, dass sie ihr Gold verschenkt“. Nein, sie kaufen in der Sekunde um hunderte Millionen Dollar den Gold-Fake ein - und verlieren damit Milliarden. Wenn man nun das Wort "Müll“ durch "Hypothekenbesicherte Wertpapiere“ ersetzt erhält man eine zwar simple aber zutreffende Geschichte der globalen Finanzkrise.
Eine Schönung
Im Film "Margin Call - der große Crash“ passiert genau das. Eine Horde Investmentbanker bringt den Finanzglobus ins Wanken. Eine bereits relativ abgegriffene Gespenstergeschichte, könnte man meinen - ja sicher. Sie wäre auch nicht weiter spannend - wäre sie nicht so fürchterlich wahr. Noch mehr: Die Verschlagenheit der Müllverkäufer und die Dummheit der Käufer sind eigentlich noch untertrieben. Denn was der Film verschweigt, ist, dass es vor der Krise dumme oder verschlagene Juristen, Ökonomen und Politiker auf der ganzen Welt gab, die all das ermöglichten. Es gab auch all die angesehenen Banker und Kundenberater, die den Bürgern den Müll, den sie gekauft hatten, auch noch aufschwatzten. Und schlussendlich war das auch der Bürger, der den Müll als Kapital für schlechtere Tage hortete und von nichts wissen konnte - und wollte.
Doch damit beschäftigt sich "Margin Call“ nicht. So gesehen können wir Hollywood dankbar sein. Dieses Mal hat es untertrieben. Regisseur J.C. Chandor findet nach 109 Minuten erstklassiger Unterhaltung sogar ein schlüssiges Ende seiner Handlung. Verglichen damit zieht sich die dritt- bis viertklassige Realität wie eine Schmierentragödie ohne Höhepunkte bis heute.
Aber der Reihe nach. Margin Call beginnt mit einem schönen Tag, an dem in einer großen New Yorker Investmentbank, mutmaßlich Lehman-Brothers, just jene Menschen gekündigt werden, die für die Analyse des Risikos von Veranlagungen zuständig sind. Das allein ist schon die schöne Karikatur eines Systems, das seine Kontrolleure systematisch freistellte im Sinne einer vollkommen absurden Kosten- und Gewinnlogik mit logischen Konsequenzen: Ab den 90er-Jahren war das Wachstum ohne Sicherheitsgurt und Bremse unterwegs in der Hoffnung, es gäbe in der Finanzwelt keine Schwerkraft. Just da aber tritt sie ein - auch im Film. Ein junger Analyst entdeckt, was innerhalb der Firma eigentlich schon viele wussten: Dass die mathematischen Modelle für Immobilienanlagen nicht halten, sondern das ganze System kippt. Dass das Unternehmen vor dem Zusammenbruch steht. Die Bank entscheidet sich nun, das als Müll erkannte Vermögen mit hohen Buchwert-Verlusten zu verkaufen - zum Schaden Dritter.
Regisseur Chandor trifft mit seiner Sicht der Schuldenveräußerung wieder einen äußerst schmerzhaften Punkt. Aber auch hier untertreibt er. In der Realität verkauften die Banken ihren Müll nicht nur ihren Konkurrenten, sondern vor allem ihren Regierungen. Dieser Vorgang vollzieht sich in Kaskaden politischer Verantwortungslosigkeit ja bis hin zur griechischen und italienischen Misere: Wirtschaftseinbruch, Arbeitslosigkeit, Aufstand.
Von den verglasten Etagen der Investmentbank aus gesehen ruhen die Sorgen dieser Welt der so bezeichneten "normalen Menschen“ in schwindelerregender Tiefe vor den Sicherheitsschleusen ihres Wolkenkratzers. In diese Welt draußen bewegt man sich nur, um sich ins "Chillout“ zu saufen, oder im Bordell Prostituierte zu bespringen.
Mehr Sprung als Fall
Hoch oben über dem Pflaster ist die Welt hart und gnadenlos die Konkurrenz. Dazu braucht es eine Lust am Irrsinn, der im Film kulminiert, als Investmentbanker Will (Paul Bettany) jungen Kollegen den Sturz vom Dach des Hauses erklärt: "Die Angst besteht nicht darin, zu fallen, sondern springen zu wollen.“ In der Tat: Irgendwann zwischen 1990 und 2007 ist dieser freiwillige Sprung der Finanzbranche in den Abgrund erfolgt - und das ist nicht einmal das Erstaunlichste an der Geschichte. Viel bemerkenswerter ist, dass unten auf der Straße per Gesetz die Sprungtücher zur Seite geräumt wurden.
Nicht nur seiner Dialoge wegen besticht "Margin Call“. Er malt auch die Figuren wie Charakterskizzen eines ganzen Berufsstandes. Nehmen wir einmal den Investmentbank-Chef John Tuld, dargestellt von Jeremy Irons. Sein Erfolgsprinzip ist es, das Gesetz des Handelns um jeden Preis zu behalten. Also setzt er Aktionen. Mit Kompetenz oder Wissen haben diese Handlungen kaum etwas zu tun. Tuld versteht die mathematisierten Produkte nicht, mit denen er Jahr für Jahr Milliarden verdient hat. Aber er entscheidet: Kaufe, verkaufe, tausche, täusche. Diese Taktik hat Riesenerfolg. Die Welt draußen glaubt, Tuld handle, weil er verstanden habe.
Nun, seit 2008 glaubt sie es nicht mehr. Sie glaubt Tuld nicht - und allen anderen auch nicht. Das ist die eigentliche Krise: Unserem Vertrauen ging es wie dem Hund eines Hauptprotagonisten von "Margin Call“ - eingeschläfert und nächtens begraben im Garten der Villa eines Bankers.