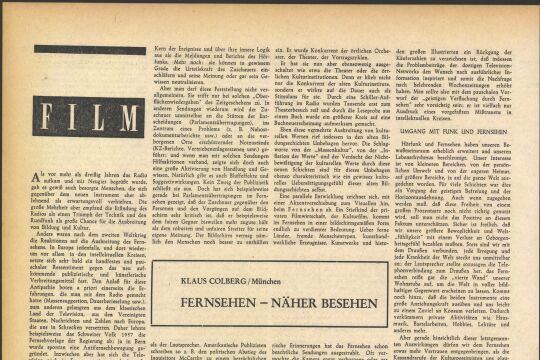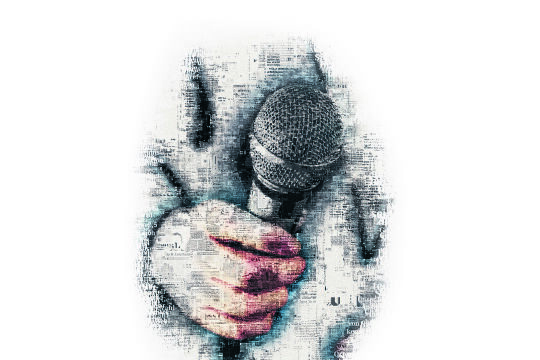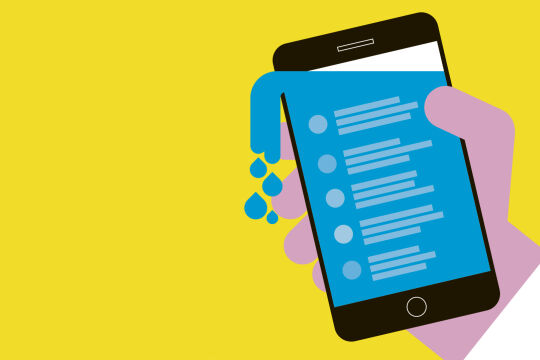USA - Europa: Über die Rolle der Medien diesseits und jenseits des Atlantiks.
Viele Gemeinsamkeiten gibt es in der Medienlandschaft der USA und Europas nicht. Am ehesten findet man hüben wie drüben die großen Konzernhäuser, die von den USA ihren Ausgang genommen haben und die nun auch in Europa viele Fernseh- und Presseerzeugnisse unter einem Dach versammelt haben. Ein wesentlicher Unterschied besteht sicher in dem Naheverhältnis, das zwischen Politik und Medien herrscht - das ist jedenfalls in Frankreich, Deutschland und Österreich ausgeprägter als in den USA, auch wenn es eine Tendenz gibt, Handlungen, die vom Weißen Haus ausgehen, unkritischer zu betrachten, als das vielleicht früher der Fall war.
In den USA haben vor allem die großen Zeitungen ihre Rolle immer als eine Art watchdog gesehen: sie haben aufgepasst, dass das, was die jeweilige Regierung oder mächtige Industriekapitäne tun, auch seine gesetzliche Grundlage hat. Ich kenne viele amerikanische Politiker und Wirtschaftsbosse, die nach einem bestimmten Verhalten oder nach bestimmten Äußerungen auf Grund des Drucks, der von den Medien ausgeübt wurde, zurücktreten mussten. In Österreich kenne ich mehr Journalisten, die auf Druck der Politiker heute nicht mehr in der Funktion sind, in die sie von anderen Politikern zuvor "hineininterveniert" wurden.
Der Fall Jayson Blair
"Eine ganz spezielle Rolle von Journalisten besteht darin, unsere Kultur, Rechenschaft abgeben zu müssen, aufrechtzuerhalten": Das schreiben Leonard Downie und Robert Kaiser in ihrem hochinteressanten Buch "The News About the News", das im vergangenen Jahr erschienen ist. "Rechenschaft abgeben zu müssen, heißt auch, die Mächtigen zu kontrollieren", liest man in dem Buch weiter. Und als Beispiele führen sie dann an: "Unsere Politiker wissen, dass informierte Wähler sie aus dem Amt entfernen können. Jeder, der versucht, diese Macht zu missbrauchen, schaut über seine oder ihre Schulter, um sich zu vergewissern, ob ihnen nicht jemand zusieht - im Idealfall sollten sie einen Journalisten im Rückspiegel sehen." Wenn man sich die Berichterstattung über das Verhalten einiger großer Konzerne (z. B. Enron) ansieht, dann haben sicher Journalisten einiges zur Aufklärung beigetragen. Für die Politik, so fürchte ich, trifft das immer weniger zu. In letzter Zeit war der Rückspiegel selbst bei so angesehenen Zeitungen wie der New York Times einigermaßen verstellt oder verschmiert.
Vor einigen Wochen ist der Fall Jayson Blair durch die Medien gegangen. Es ging um einen Reporter der NYT, dem vorgeworfen wurde, sich in den vergangenen zwei Jahren bei vielen Artikeln künstlerische Freiheiten genommen zu haben: oft war Blair gar nicht am Schauplatz gewesen, wie etwa bei Schießereien im Großraum von Washington im Spätherbst des vergangenen Jahres, oft hatte er mit den Quellen, die in seinen Artikeln zitiert werden, gar nicht gesprochen, hie und da hatte er sogar von anderen Zeitungen abgeschrieben. Beeindruckend ist allerdings, wie die Zeitung mit diesem Vorfall umgegangen ist: Zunächst gab es eine vierseitige Richtigstellung, die in aller Ausführlichkeit jeden einzelnen Fehler in Blairs Artikeln schilderte. Dann stellten sich der Chefredakteur und der Herausgeber der New York Times in einem Kinosaal den Kollegen aus dem News-Room in einer Art Rede-und-Antwort-Session - und darüber war dann am nächsten Tag auch noch in der Zeitung zu lesen. Das heißt also: Die NYT schrieb, was die eigenen Redakteure ihrem Chef vorwerfen, wie er darauf reagiert etc. Verfasst wurde der Artikel übrigens vom Medienkritiker der Zeitung, der ausdrücklich nicht zur Versammlung eingeladen worden war, aber die Teilnehmer befragte. So etwas wäre in Österreich undenkbar. Wann haben Sie je aus dem Standard erfahren, wie es beim Standard zugeht, oder aus dem Format, was sich dort abspielt? Von anderen, bedeutenden Medien ganz zu schweigen.
11. September 2001
Das mediale Elementarereignis waren natürlich die Terroranschläge auf das World Trade Center und das Pentagon. Seit dem 11. September 2001 hat sich die Stimmungslage, was das Verhältnis der Medien gegenüber den Regierenden betrifft, geändert. Kritik am Präsidenten kommt kaum mehr vor. Ähnliches konnte man auch in den achtziger Jahren erleben, als Präsident Reagan ebenfalls mit Glacéhandschuhen angefasst wurde. Peter Jennings, der bekannte Anchorman der Abendnachrichten von ABC, meinte damals zu mir: "Wissen Sie, wenn ein Präsident derart hohe Popularitätswerte genießt, dann würden wir ja gegen die Mehrheit der Meinung der Bevölkerung berichten, und das würde uns bei den Einschaltziffern nur schaden." Nicht viel anders verhält es sich wohl jetzt.
Kriege sind immer ein guter Gradmesser für das Verhältnis der Regierungen zu den Medien. Natürlich macht es einen großen Unterschied, wer diesen Krieg führt und ob die jeweiligen Medien nun gerade ein Teil des kriegführenden Landes sind oder neutrale Beobachter. Generell haben die amerikanischen Medien vom Schauplatz Irak oder auch vom Schauplatz Washington anders berichtet als die europäischen. Mitentscheidend dafür war sicher die negative Haltung der Bevölkerung diesem Krieg gegenüber in allen europäischen Ländern, ganz unabhängig davon, wie sich die Regierungen verhielten. Das seriöseste Medium war, wie so oft, die BBC. Zu diesem Schluss kommen auch amerikanische Beobachter, wie etwa Michael Massing, der in der jüngsten Ausgabe der angesehenen New York Review of Books schreibt: "Die BBC, mit 200 Reportern, Produzenten, und Technikern - so vielen Mitarbeitern wie nie zuvor - die BBC also hat ein Programm angeboten, das von no-nonsense-Moderatoren geleitet wurde, von Korrespondenten, die bei ihren Fragen nicht nachgegeben haben, man sah umfassende Reportagen, und bekam eine Menge von Kommentatoren zu hören, deren Kenntnis über das Geschehen im Nahen Osten sich wohltuend von den Generälen und Brigadieren unterschied, die im amerikanischen Fernsehen auftraten."
Wirklich interessant war es, wenn man die Gelegenheit hatte, CNN in den USA und CNN International zu verfolgen: das war, als würde man zwei voneinander völlig unabhängige Nachrichtensender betrachten. Was wir hier in Europa auf CNN zu sehen bekommen, unterscheidet sich schon an normalen Sendetagen ziemlich deutlich von der amerikanischen Version. In den 80er und frühen 90er Jahren strahlte CNN im wesentlichen das amerikanische Programm über einen Satelliten nach Europa aus. Die Führung in Atlanta, dem Hauptquartier von CNN, gelangte dann aber zur Ansicht, die Europäer würden einem Programm, das mehr Betonung auf europäische Inhalte legt, auch mehr Aufmerksamkeit schenken. Also baute CNN sein Büro in London stark aus, immer mehr Sendungen wurden von dort aus moderiert.
Beim Irak-Krieg traten die Unterschiede nun besonders krass hervor. Noch einmal Michael Massing von der New York Rieview of Books: "Zuhause - also in den USA - habe ich CNN verfolgt, und das hat mir vor Augen geführt, wie sehr der Sender in den letzten Jahren an Qualität verloren hat. (Die Morgenmoderatorin) Paula Zahn schaute nicht nur wie ein Cheerleader für die amerikanischen Truppen aus, sie redete auch so. (Der Abendmoderator) Aaron Brown versuchte ständig etwas Bedeutungsvolles zu sagen, aber es blieb beim Versuch. Die beiden waren freilich auf CNN International nicht zu sehen."
Der Präsident in Uniform
Jetzt ist der Krieg also vorbei, und vieles, was uns vorher eingeredet wurde, stellt sich als Chimäre heraus - am allerwenigsten freilich die Tatsache, dass das Regime von Saddam Hussein die Menschen im Irak brutal unterdrückt hat. In den Medien auf beiden Seiten des Atlantik ist wieder Normalität eingekehrt. In Österreich beispielsweise wurde das Thema "Pensionen" zur causa prima; in den USA sind die Berichte vom Kriegsschauplatz der Heldenverehrung gewichen. Dazu gehören Inszenierungen, wie jene des George W. Bush, der in voller Militäradjustierung mit einer Kampfmaschine auf einem Flugzeugträger landet und dort salutierend das Deck abschreitet. Angesichts der Küstennähe hätte auch ein Hubschrauber gereicht, aber eine Landung damit wäre im Fernsehen um vieles weniger dramatisch erschienen. Und das ist es schließlich, was im Medienzeitalter zählt. Hier wie dort.
Der Autor war von 1995 bis 2001 ORF-Korrespondent in Washington; derzeit ist er als Sonderkorrespondent und Kommentator für den ORF tätig.
Der Text basiert auf einem Vortrag, den Freund kürzlich bei einem Symposion des Forum St. Stephan zum Thema "Transatlantische Differenzen" in Wien gehalten hat.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!