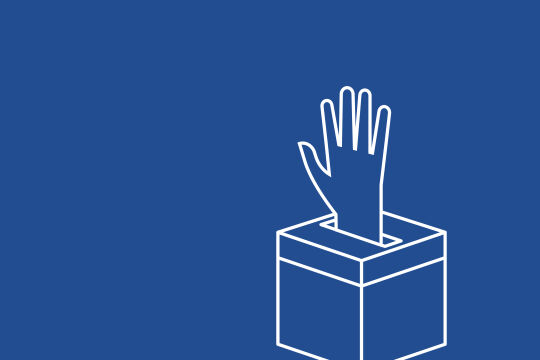" Direkte Demokratie wird vielfach 'von oben' eingesetzt. Sieglinde Rosenberger fragt daher, ob es sich um ein Instrument der Bürger oder um Regierungstechnik handle."
Politik mit Stimmung?
Die FPÖ fordert künftig verpflichtende Volksabstimmungen zu Bürgerinitiativen, die von mehr als vier Prozent der Wahlberechtigten (ÖVP: mehr als 10 Prozent) unterstützt werden.
Derzeit steht der Ausbau direkter Demokratie zur Diskussion. Befürworter betonen dabei die Möglichkeit der Bürger, ihre Anliegen durchzusetzen und erinnern an die Weisheit der Vielen. Mahner warnen hingegen vor Kampagnendemokratie. Beide beziehen sich auf die Schweiz als Vergleichsbild. Dieses bleibt aber oft diffus - und es bleibt allein. Andere Erfahrungen mit direkter Demokratie und neue Entwicklungen werden kaum diskutiert.
Die Geschichte der modernen Demokratie ist eng mit jener des Rechtsstaats verbunden. Herrschaft sollte diszipliniert und begrenzt werden -was zum parlamentarischen Regierungssystem mit "checks and balances" führte und zu Institutionen, die zusammenarbeiten müssen. Doch das macht Politik in den Augen vieler mühsam und langweilig. Es kann auch, und das wurde schon früh beobachtet, zur Festschreibung bestehender Verhältnisse führen.
Die Kritik an der repräsentativen Demokratie ist folglich so alt wie diese selbst. Sie reicht von Jean-Jacques Rousseau und der Romantik über sozialistische Bewegungen und organische Vorstellungen des Volkes bis zur Übernahme von Denkweisen der Informatik. Immer geht es darum, dem als schwerfällig und abgehoben wahrgenommenen repräsentativen System etwas entgegenzusetzen, das mit Missständen aufräumt und Neues ermöglicht.
Die Schweiz als Sonderfall
Diese Kritik hat die Entwicklung der modernen Demokratie - nicht nur in der Schweiz -begleitet und vielerorts zu Anpassungen geführt. Dabei war es entscheidend, die Änderungen in das bestehende Grundmodell zu integrieren, sie also wie parlamentarische Entscheidungen in rechtsstaatlichen Grenzen zu fassen. Damit ist beides, die Willensbildung in repräsentativer und direkter Demokratie, das Ergebnis demokratischer Verfahren. Beide sind daher nie Ausdruck unmittelbarer Willensäußerung. Die Unterschiede liegen in der Frage, ob institutionelle Orte und Verfahren vorhanden sind, um stetige Auseinandersetzung und Einfluss auf die Entscheidungsfindung zu ermöglichen - sei es durch Beteiligung oder Kompromissbildung. Praktisch folgt daraus, dass Instrumente direkter Demokratie nicht isoliert betrachtet und verglichen werden können. Es kommt darauf an, wie sie in das jeweilige politische System eingebettet sind.
Die Schweiz hat ein politisches System, das kaum mit anderen vergleichbar ist. Was es ausmacht ist eine Konzentrationsregierung, die alle großen politischen Interessen vertritt, und deren Zusammensetzung seit 1959 feststeht. Dieser Bundesrat kann vom Parlament nicht abgesetzt werden. Dazu kommt das Volk als Kontrollorgan. Direkte Demokratie und Versammlungsregierung stehen einander als Korrektiv gegenüber. Aber Volksinitiativen auf Bundesebene können nur die Verfassung betreffen. Wenn eine Initiative angenommen wird, folgt ein Gesetzgebungsauftrag. Es liegt in der Hand des Parlaments, die genauen Umsetzungsschritte zu treffen. Auch die Verfassungsgerichtsbarkeit ist beschränkt. Das Bundesgericht kann keine Gesetze aufheben.
Direkte Demokratie in der Schweiz ist also ein komplexes Zusammenspiel vieler Institutionen. So werden im Vorfeld des parlamentarischen Prozesses alle maßgeblichen Akteure eingebunden, um später Veto-Referenden gegen Gesetzesbeschlüsse zu verhindern. Andererseits gibt es eine große Zurückhaltung, Initiativen für unzulässig zu erklären, weil man dem Volk nicht widersprechen will. Dann folgen lange Debatten über die Umsetzung von Initiativen. Und zunehmend nutzen Parteien direkte Demokratie für ihre Kampagnen.
Volksbefragungen "von oben"
Die Verfassung Deutschlands weist mehr Ähnlichkeiten mit jener Österreichs auf. Hier gibt es direkte Demokratie aber nur auf Gemeinde-und Landesebene. In den Ländern sind die Verfahren mehrstufig und darauf ausgelegt, dass Vorschläge zweimal im Landtag behandelt werden müssen, ehe eine Volksabstimmung stattfinden kann. Das soll zu Diskussion und Kompromissfindung verpflichten. Politische Parteien nutzen diese Instrumente bewusst nicht. Aber auch hier kann es, wie vor allem Beispiele aus Hamburg zeigen, dazu kommen, dass lautstarke Gruppen Landtage dazu bewegen, ihre Forderungen zu übernehmen um lange Kampagnen zu vermeiden.
Von vielen unbeachtet gehört auch Slowenien zu jenen Staaten, in denen direkte Demokratie besonders intensiv genutzt wird. Hier hat sie sich -wie in anderen post-kommunistischen Staaten - vor allem zu einem Instrument der Oppositionsparteien entwickelt.
Direkte Demokratie in Form von Volksbefragungen und Referenden wird vielfach auch "von oben" eingesetzt. Referenden etwa in Ungarn oder die Befragung über den Brexit wurden von den Regierungen angeordnet und sollten bestimmte politische Entscheidungen verstärken. Die Politikwissenschaftlerin Sieglinde Rosenberger fragt daher, ob es sich um ein Instrument der Bürger oder um Regierungstechnik handle.
All diese Verfahren stammen aus einer Zeit, in der Medien anders organisiert waren als heute. Nur Deutschland sticht mit seinem Zwang zu parlamentarischen Debatten und dem Ziel der Kompromissfindung heraus. In der Schweiz stützt Medienvielfalt, wie es sie sonst kaum in Europa gibt, lange Debatten. Erfahrungsgemäß ist die Beteiligung an direkter Demokratie dennoch gering und auf bestimmte Bevölkerungsgruppen beschränkt. Wer etwas initiieren will, braucht neben Mut auch Wissen, Kommunikationsmittel und Durchhaltevermögen. Unter einem Jahr tut sich kaum etwas. Anders ist es, wenn Regierungen, Parteien oder Verbände diese Instrumente nutzen. Anders ist es auch, wie die besonders erfolgreichen Volksbegehren in Österreich zeigen, wenn es "gegen etwas" geht.
Mehr als Ja-/Nein-Entscheidungen
Interessanterweise ist es der Verwaltungsbereich, in dem weltweit nach Alternativen zu diesen Entwicklungen gesucht wird. Der Politikwissenschaftler Mark Warren spricht von einer "verwaltungsgetriebenen Demokratisierung". Dahinter steht die Frage, warum Politik auf Ja-/Nein-Entscheidungen und Emotionen reduziert wird, wenn in anderen Lebensbereichen viel komplexere Leistungen von uns verlangt werden. Wie können Einsichten, Wissen und Erfahrungen von Menschen in politische Prozesse gebracht werden? Und ist es möglich, mehr als "die üblichen Verdächtigen" dafür zu gewinnen?
Die Innovationen, die hier entwickelt werden, sind keine bloße Alternative zur direkten Demokratie. Sie sprechen auch die Funktionsprobleme und die Überforderung der Parteiendemokratie und Parlamente an. Es geht darum, Beteiligungsmöglichkeiten zu schaffen, die vielen (auch zeitlich und intellektuell!) offen stehen, und diese mit den politischen Entscheidungsträgern zu verbinden. Ziel ist, Bürger und Institutionen zu stärken und dem politischen Prozess neue Glaubwürdigkeit zu verschaffen. Das passiert etwa in Vorarlberger Gemeinden oder im Land Salzburg in Bürgerräten. In Irland wurde auf diese Weise von Bürgern und Parlamentariern eine Verfassungsreform vorbereitet, und in Australien wurde die politisch verfahrene Frage atomarer Endlager gelöst. In Israel ist man auf diese Weise sogar das jahrzehntealte Problem der Integration äthiopischer Juden angegangen.
Der entscheidende Unterschied zwischen diesen Ansätzen und direkter Demokratie ist, dass man nicht auf Intuition und Stimmungen vertraut, sondern gezielt Rahmenbedingungen schafft, die den vielen Stimmen in einer Gesellschaft Gehör verschaffen können. Es ist klar, damit können nicht alle Probleme gelöst werden. Erfahrungsberichte zeigen aber, dass Menschen mit sehr nüchternen Erwartungen in solche Prozesse gehen, aber gestärkt für Demokratie herauskommen. Und will man nicht gerade das durch Demokratiereformen erreichen?
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!