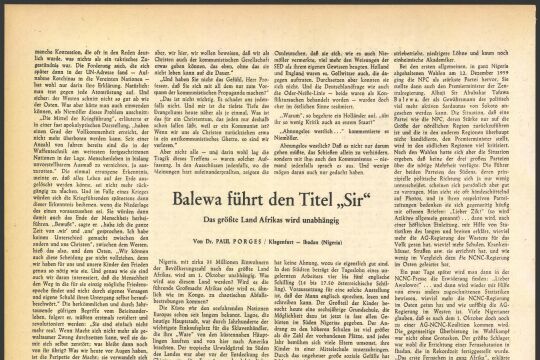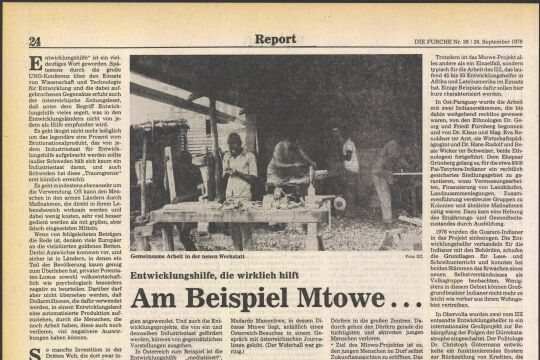Während in der Küstenregion von Mombasa der Tourismus floriert, hungert und dürstet die Bevölkerung im Norden Kenias. Ein Lokalaugenschein von Doris Becker.
In der Region Marsabit sind nach unzureichenden Regenfällen die Viehbestände fast vollständig vernichtet, die Frauen müssen weite Strecken zu Fuß zurücklegen, um Wasser für ihre Familien zu holen. Hilfe muss von außen kommen. Denn die Regierung kümmert sich nicht ausreichend um die Probleme der Nomaden.
Nairobi empfängt uns kühl und regnerisch. Es ist August, Winter in Kenia, die Menschen in der Hauptstadt frösteln. Auf unserem Flug nach North Horr liegen unter uns erst blühende Landschaften, Felder kurz vor der Ernte. Doch je weiter wir in den Norden kommen, desto mehr verändert sich die Landschaft, wird karg und lebensbedrohlich. Als wir auf der Landebahn mitten im Nirgendwo zum Stillstand kommen, empfängt uns als erster stummer Zeuge der Katastrophe der vollkommen vertrocknete Kadaver eines Kamels, vor Wochen verdurstet hier im Distrikt Marsabit, dessen Fläche fast so groß ist wie jene Österreichs. Das fast vollständige Ausbleiben des Regens im vergangenen November und die unzureichenden Niederschläge während der Hauptregenzeit im April haben zur Katastrophe geführt: 70 bis 90 Prozent des Viehbestandes, Ziegen, Schafe und Kamele, sind verendet und damit die Lebensgrundlage der Nomaden hier im Norden Kenias vernichtet. Die nächste Regenzeit wird erst für Ende Oktober erwartet, und niemand weiß, wieviel Vieh bis dahin noch sterben wird. Milch ist das Hauptnahrungsmittel, ganz besonders für die Kinder - viele leiden an Mangelernährung.
Über zehn Prozent betroffen
Schon zu Jahresbeginn hat die Regierung in Nairobi vor einer Hungerkatastrophe im Norden gewarnt und um internationale Unterstützung gebeten, nach eigenen Angaben hat sie im Frühjahr 59 Millionen Euro für Nothilfe ausgegeben. Die UNO schätzt die Zahl der Betroffenen im Grenzgebiet Kenias, Äthiopiens und Somalias auf insgesamt 11 Millionen Menschen, allein in Kenia sind es 3,5 Millionen, das sind mehr als zehn Prozent der Bevölkerung. Organisationen wie die Caritas haben auf diesen Hilferuf reagiert und Wasser-und Lebensmittelverteilungen organisiert. Doch die Menschen wollen nicht auf Dauer auf Unimix, eine Getreidemischung mit viel Mais und Zucker, angewiesen sein, sie wollen selbst für den Lebensunterhalt ihrer Familien sorgen können. Und dazu brauchen sie - vor allem in den am schlimmsten betroffenen Gebieten - neben lebensnotwendigem Wasser auch wieder genug Vieh.
Die Caritas engagiert sich im Rahmen ihres internationalen Netzwerks in beiden Feldern. Rund 170.000 Menschen wurden heuer bereits mit Wasser-und Lebensmittelhilfe unterstützt, 85.000 Euro hat die Caritas Österreich bisher dafür zur Verfügung gestellt. "Weitere Spenden werden dringend gebraucht, um die Wasserversorgung bis zur nächsten Regenzeit zu sichern", sagt Caritasdirektor Michael Landau nach seinen Gesprächen mit Projektpartnern. Die verbliebenen Lastenkamele der Nomaden sind zu schwach, um die 50 bis 80 Kilometer weiten Strecken bis zur nächsten Wasserstelle zurückzulegen. Gemeinsam mit der PISP, einer lokalen NGO, organisiert die Caritas deshalb mobile Wassertransporte: LKWs mit 8000 Liter Fassungsvermögen befüllen jeden Tag Wassertanks etwa zwischen der Stadt Kalacha und der Grenze zu Äthiopien. Die Frauen, die für die Versorgung der Familie mit Wasser verantwortlich sind, müssen so "nur mehr" bis zu 10 Kilometer täglich zu Fuß zurücklegen. 20 Liter erhält eine Familie derzeit pro Tag für sich und ihr Kleinvieh.
Dürren werden häufiger
"Ohne diese Hilfe könntet ihr uns hier nicht mehr besuchen", macht uns einer der Dorfältesten bei einer traditionellen Ratssitzung der Gabbra, einem von acht größeren Nomadenstämmen der Region, die Dramatik der Lage bewusst. Dieser Rat, der nur aus Männern besteht, trifft alle Entscheidungen für den Stamm, fünf solcher Räte gibt es bei den Gabbra, die etwa 50.000 Mitglieder im Norden Kenias zählen. Die Dankbarkeit dieser Menschen ist nicht überschwänglich, sondern ernst und tief. Sie haben sich an die unwirtlichen Lebensumstände angepasst, gelernt, mit Dürre und Hunger umzugehen. Warum es nun zur Katastrophe gekommen ist? Keiner dieser alten Männer kann sich erinnern, dass die Dürre schon einmal so schlimme Folgen gezeitigt hätte, dass ihr so viel Vieh zum Opfer gefallen wäre. Und: die Dürren werden häufiger. Traten sie in der Vergangenheit etwa alle zehn Jahre auf, so ist mittlerweile eher alle drei Jahre damit zu rechnen. Und der Regen, der dazwischen fällt, ist meist nicht ausreichend. Nach Schätzungen von Experten wird es noch mindestens bis 2007 dauern, bis sich die Weiden wieder erholt haben.
Wenn es in Kenia regnet, dann kurz und heftig. Um das Regenwasser längerfristig nutzbar zu machen, hat die PISP ausgeklügelte Verfahren zur Speicherung, so genannte Water-Harvesting-Projects, entwickelt. Wir besichtigen ein solches Projekt in Forolle, direkt an der kenianisch-äthiopischen Grenze. In insgesamt 24 unterirdischen Regenwassertanks mit vorgelagerten Filtern werden jeweils bis zu 150.000 Liter Wasser gespeichert. "Es gibt kein Leben ohne Wasser, die Menschen könnten hier ohne die Hilfe nicht leben", bringt der Area-Chief Mr. Gura seine Dankbarkeit schnörkellos zum Ausdruck. In Forolle werden wir mit einem Problem konfrontiert, das die Auswirkungen der Dürre verschärft hat: ethnische Konflikte. War es früher üblich, dass die Nomaden beidseits der Grenze diese überschritten und sich die Ressourcen - Wasser auf der einen, Weideland auf der anderen Seite - teilten, ist das nun nicht mehr möglich. Seit bei Überfällen mehrere Menschen getötet wurden, sind auf beiden Seiten der Grenze Militärposten stationiert. Die Lage ist zwar nun wieder stabil, doch der wechselseitige Zugang zu den Ressourcen gekappt. Verlierer sind also beide Seiten.
Neubeginn für Turbi
"Die extreme Armut der Menschen ist einer der Gründe für diese Überfälle", erklärt uns Wario Guyo, ein PISP-Mitarbeiter. Viehdiebstahl ist nichts Ungewöhnliches in dieser Region, in der Ziegen, Schafe und Kamele Lebensgrundlage, Einkommensquelle und der ganze Stolz ihrer Besitzer sind. Doch niemand kann sich an einen Überfall erinnern, der in seiner Brutalität dem Massaker in Turbi gleicht, dem im vergangenen September mehr als 60 Menschen zum Opfer gefallen sind. Turbi ist wie Forolle ein kleiner Ort im Grenzgebiet mit relativ gutem Weideland und auch mit einer nahe liegenden Wasserstelle. 311 Familien, das sind etwa 1900 Menschen, leben dort. An einem frühen Morgen im letzten Juli stürmten Guerilla-Gruppen den Ort, töteten wahllos, auch Frauen und Kinder, drangen sogar in die Schule ein und raubten schließlich fast den gesamten Viehbestand. Zurück blieben Menschen, die alles verloren haben, nicht nur ihr Vieh, sondern auch Eltern, Kinder, Ehepartner. Dass die Regierung nun eine Polizeistation hier einrichtet, erfüllt die Menschen mit Bitterkeit: "Sie kommen immer zu spät."
Um den Menschen wieder auf die Beine zu helfen, hat die Caritas gemeinsam mit der PISP ein Restocking-Programm für Turbi gestartet: die am schwersten Betroffenen - Waisenkinder, Witwen - bekommen 20 weibliche und fünf männliche Ziegen und Schafe. "Nach diesem Überfall dachten wir, dass wir uns nie wieder davon erholen würden", erzählt uns einer der Dorfältesten von Turbi. "Jetzt können wir wieder nach vorne schauen." "Wir können den Verlust dieser Menschen nicht wieder wettmachen", sagt Landau. "Aber wir können ihnen wieder eine Lebensgrundlage geben." 20 Euro kostet eine Ziege, die Caritas bittet um Spenden, um mehr Menschen helfen zu können.
Manager des Wandels
"Wir sind Manager des Wandels", umschreibt Frances Chachu Ganya, der umtriebige Direktor der PISP, die Rolle seiner Organisation. Seit zehn Jahren arbeitet die PISP für die Menschen in dieser Region, besitzt ihr Vertrauen. Nur so kann Schritt für Schritt Neues entstehen, neue Methoden zur Wasserspeicherung, aber auch der bessere Zugang zu Bildung für die Nomadenkinder. In Kalacha unterstützt die PISP beispielsweise ein Mädcheninternat mit 410 Schülerinnen. Ein Blick in die Gesichter dieser jungen Mädchen, die sich voll Wissbegier über ihre wenigen Bücher und Hefte beugen, gibt Anlass zur Hoffnung: "Bildung bedeutet Zukunft, auch und ganz besonders hier in Afrika", resümiert Caritas-Direktor Landau. Zumindest im Schulbereich hat sich unter der gegenwärtigen Regierung einiges zum Besseren gewendet: die Lehrer, wenn auch zu wenige, werden vom Staat bezahlt, früher mussten dafür die Missionen aufkommen.
Mit dem Koordinator in der Diözese Marsabit, James J. Galgallo, hat die Caritas einen starken Partner. Er versteht sich auch als Vermittler und Anwalt, richtet Dialoggruppen ein, bringt die Menschen an einen Tisch, stellt auch der Regierung hin und wieder die Rute ins Fenster, wenn sie säumig ist, zum Beispiel beim Straßenbau. Eine Sisyphusarbeit? "Wenn man für Gerechtigkeit und Frieden arbeitet, kann man nie in Pension gehen", sagt Galgallo, und man merkt, dass er noch einen langen Atem besitzt.
Die Autorin ist Pressesprecherin der Caritas der Erzdiözese Wien und war Anfang August mit Caritas-Direktor Michael Landau in Nordkenia.