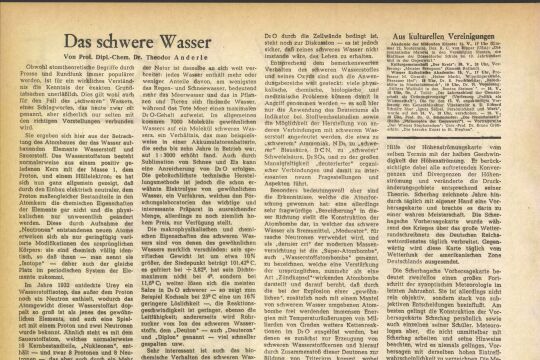Vor zwanzig Jahren gelang Wissenschaftern in England die erste kontrollierte Kernfusion. Diese Technologie könnte alle Energieprobleme lösen, dennoch mehrt sich die Kritik.
Der 9. November 1991 war ein bedeutsamer Tag für die internationale Gemeinschaft der Kernphysiker. Nach jahrelangen Vorbereitungen wurde im englischen Forschungsreaktor JET (Joint European Torus) zum ersten Mal eine kontrollierte Kernfusion durchgeführt. Zwei Sekunden lang verschmolzen Wasserstoffkerne miteinander zu Helium und setzten dabei mit einer Leistung von zwei Megawatt Energie frei. Zwar musste mehr als die zehnfache Menge Energie aufgewendet werden, um den Prozess überhaupt erst in Gang zu bringen. Doch immerhin war damit der Nachweis erbracht, dass sich Kernfusion technisch beherrschen lässt.
Zwanzig Jahre später ist die Euphorie unter Fachleuten noch immer ungebrochen. Im französischen Cadarache begannen voriges Jahr die Bauarbeiten für eines der größten Forschungsprojekte der Geschichte: Der internationale Fusionsreaktor ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) soll erstmals mehr Energie erzeugen, als hineingesteckt wurde. Eine Erfolgsgarantie können die Forscher nicht geben. Selbst wenn alles plangemäß verläuft, würden die ersten kommerziellen Fusionskraftwerke nicht vor 2050 ans Stromnetz gehen. Zudem steigen die Kosten des Mammutvorhabens ständig an. Derzeit ist von 16 Milliarden Euro die Rede, wovon Europa 45,5 Prozent trägt. Kritiker fordern, das Geld stattdessen in Energieprojekte mit überschaubarerem Planungshorizont zu stecken.
Massendifferenz als Energie
Bei der Kernfusion verschmelzen zwei leichte Atomkerne zu einem neuen Element. Dieses hat stets etwas weniger Masse als die Summe der Ausgangsprodukte. Diese Massendifferenz steht gemäß Einsteins berühmter Gleichung E=mc2 als Energie zur Verfügung. Kernfusion findet permanent in Sternen statt. Die Physik kennt Dutzende verschiedene Fusionsreaktionen. In ITER sollen die beiden Wasserstoffisotope Deuterium und Tritium zu Helium verschmolzen werden. Aus einem Gramm dieses Brennstoffs lässt sich soviel Energie gewinnen wie aus 12.000 Kilogramm Steinkohle. Mit knapp drei Tonnen davon ließe sich theoretisch der energetische Jahresbedarf von Österreich decken - technische Verluste bei Erzeugung und Übertragung nicht einberechnet. Doch während die Fusionsprozesse im Inneren der Sonne bei 15 Millionen Grad ablaufen, erfordert die technische Fusion in Reaktoren zehn Mal so hohe Temperaturen. Erst dann wird die abstoßende Kraft der positiv geladenen Kerne überwunden. Soviel Hitze hält kein Material aus. Deshalb hat sich die Wissenschaft einen Trick überlegt. Ab etwa 100 Millionen Grad verwandelt sich der gasförmige Brennstoff in den Aggregatzustand Plasma. Plasma ist elektrisch leitfähig, kann also von Magnetfeldern "eingesperrt“ werden. ITER wird dafür Spulen aus supraleitendem Material verwenden. Diese sollen das Plasma in der reifenförmigen Reaktionskammer in Schwebe halten, ohne dass es die Wände berührt.
Um den Brennstoff auf die erforderlichen Temperaturen zu bringen, ist eine Leistung von 50 Megawatt erforderlich. Dafür wird ITER drei Heizmethoden kombinieren. Ein Transformator und eine externe Strahlungsquelle werden die Atomkerne mittels hochfrequenter Mikrowellen anregen. Zusätzlich will man elektrisch neutrale Teilchen in die Brennkammer schießen, die ihre Energie mittels Kollisionen an die Kerne abgeben. Sobald das Plasma brennt, also Helium produziert wird, sollen die Kernreaktionen einen Teil der benötigten Heizenergie selbst aufbringen. Die externen Heizquellen könnten dann entsprechend reduziert werden. Bei jeder Fusion eines Deuteriumkerns und eines Tritiumkerns zu Helium entsteht ein freies Neutron, das dem Plasma entweicht und gegen die Wand der Reaktionskammer prallt. In ITER wird die dabei entstehende Wärme durch Kühltürme abgeführt. In künftigen Fusionskraftwerken soll diese Wärme Dampf erzeugen, der anschließend auf traditionelle Weise über Dampfturbinen und Generatoren Strom erzeugt.
So beeindruckend das technische Konzept ist, so vielfältig waren und sind die zu überwindenden Schwierigkeiten. "Ein Fusionsreaktor dieser Größe und Komplexität wurde noch nie zuvor gebaut“, sagt Robert Wolf vom Max Planck Institut für Plasmaphysik. "Man kann nicht alle Probleme vorhersehen.“ Der Zeitplan musste bereits etliche Male korrigiert werden, weil die Entwicklungszeiten von Komponenten zu optimistisch kalkuliert worden waren. Ein Kostentreiber sind die High-Tech-Materialien. So sind die Preise für Supraleiter und Hochtemperaturwerkstoffe in den vergangenen Jahren in die Höhe geschossen. Die Innenwand der Reaktionskammer beispielsweise muss über mehrere Jahre dem ständigen Bombardement der frei gesetzten Neutronen standhalten. Sie soll aus dem extrem widerstandsfähigen Werkstoff Wolfram bestehen. Leider hat sich der Wolframpreis seit 2002 verneunfacht.
Ernüchterung brachte ein 2009 veröffentlichter Bericht des Büros für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB). Demnach sei bis zur (möglichen) Realisierung der Stromerzeugung durch Kernfusion in den nächsten 50 Jahren "mit Investitionen um Umfang von 60 bis 80 Milliarden Euro zu rechnen“. Solche Diagnosen rufen Kritiker auf den Plan.
Kritik am "Milliardengrab“
So veröffentlichten vergangenes Jahr mehrere Wissenschafter, darunter der ehemalige Physik-Nobelpreisträger Georges Charpak einen Beitrag in der französischen Tageszeitung "Libération“. Darin fordern sie, lieber in Atomkraftwerke der vierten Generation zu investieren, also in die Kernspaltung, statt in die Kernfusion. Mit anderen Alternativen argumentieren europäische Grünparteien gegen das "Milliardengrab ITER“. "Wir haben jetzt ein Klimaproblem“, meint die grüne Nationalratsabgeordnete Christiane Brunner. "Selbst wenn die Kernfusion 2055 einsatzbereit sein sollte, ist es bereits zu spät.“ Sie fordert deshalb den sofortigen Ausstieg Österreichs aus dem Euratom-Vertrag, der - unter anderem - die Finanzierung der Fusionsforschung regelt. "Man sollte besser den Ausbau erneuerbarer Energien vorantreiben.“
Der gewaltige Zeithorizont der Kernfusionsentwicklung ist dem gegenwärtigen Denken in Quartalen oder Legislaturperioden fremd. 2019 soll in ITER das erste Plasma produziert werden, ein paar Jahre später die erste Fusion stattfinden. Kann der Reaktor mehr Energie erzeugen als er verbraucht, wird in den 2030er Jahren eine weitere Demonstrationsanlage in industriellem Maßstab gebaut. 20 Jahre später könnten die ersten kommerziellen Kraftwerke in Betrieb gehen. "ITER wird zeigen, dass die Kernfusion physikalische, technisch und auch wirtschaftlich funktionieren kann“, ist Fritz Aumayr, Vizedirektor des Instituts für Angewandte Physik der TU Wien, überzeugt. "Wenn der Reaktor erst einmal läuft, wird sich auch die Skepsis legen.“