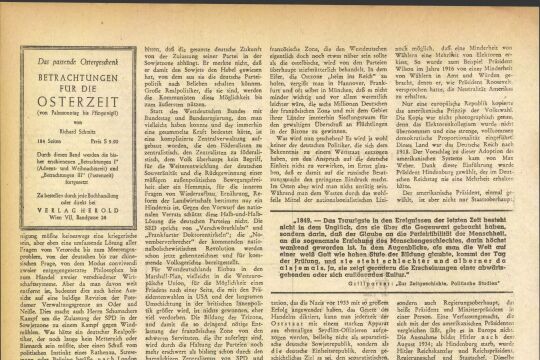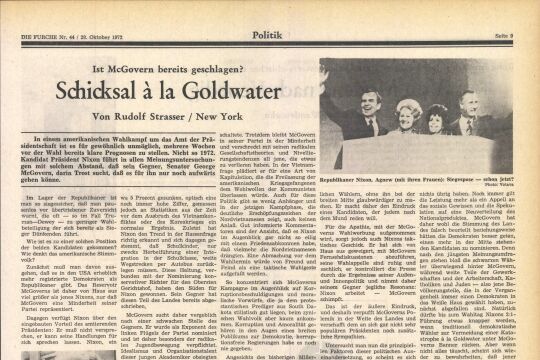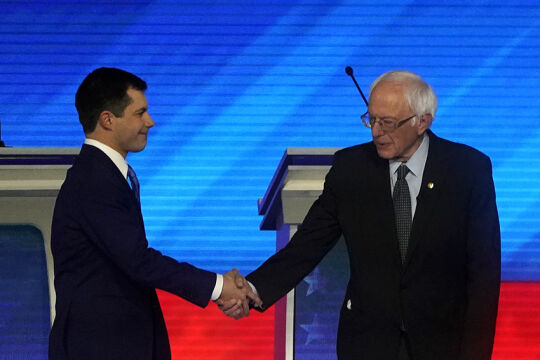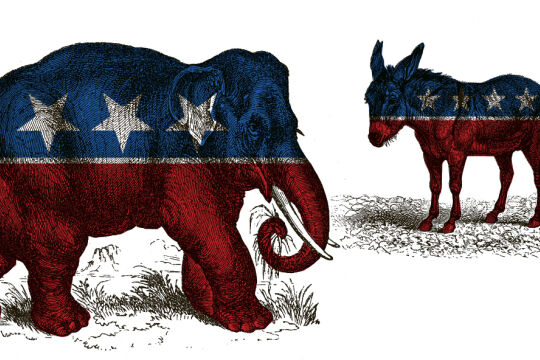Was führte zum deutlichen Sieg des demokratischen Kandidaten Barack Obama?Ein Rückblick auf einen langen und harten Wahlkampf ums Weiße Haus.
Die Präsidentschaftswahl 2008 war ein überlanger Wahlmarathon, der eigentlich schon während des Parteitags der Demokraten 2004 in Boston begonnen hat. Damals wurde der (noch) Senats-Kandidat aus Illinois, Barack Obama, mit seiner eloquenten Rede zur Sensation und zur Zukunftshoffnung der Demokratischen Partei. Er wurde noch im darauf folgenden Herbst zum Senator gewählt, zwei Jahre später kündigte er seine Kandidatur an. Zwei Jahre lang befand sich der unermüdliche und immer frisch wirkende Obama auf dem "campaign trail". Er lernte rasch und wurde mit jedem Tag ein schlauerer Politiker, der gerade in außenpolitischen Fragen dazulernte. Das gibt Hoffnung auf einen "schnellen Lerner" im Weißen Haus, was auch die jungen, relativ unerfahrenen Gouverneure Jimmy Carter und Bill Clinton 1976 und 1992 als frisch gewählte Präsidenten auszeichnete.
Obama machte aber auch Fehler, die ihn die Wahl hätten kosten können. Im Winter 2008 waren es die Schwierigkeiten mit seinem "radikalen" Pastor Jeremiah Wright. Diese wiegelte er mit einer grundlegenden Rede zum "Rassenproblem" ab. Im April machte er einen ungeschickten Sager vor einer kleinen Gruppe seiner Anhänger in San Francisco. Damals meinte er, Leute in den Kleinstädten von Pennsylvania und anderswo seien "verbittert" über Kündigungen und verlorene Jobs und "klammern sich an Waffen und Religion fest, oder haben Antipathien gegenüber Leuten, die anders sind als sie".
Kampf um die weißen Männer
Diese Feststellung stand im krassen Gegensatz zu einer Prämisse seines Wahlkampfs: Die elitäre Demokratische Partei müsse sich wieder mehr um die enttäuschten weißen Männer bemühen, wenn sie nationale Wahlen gewinnen wolle. Diese weiße Arbeiter- und Mittelklasse war seit Franklin Roosevelt Teil der Wählerkoalition, die Demokraten ins Weiße Haus brachte. George W. Bush schlug 2004 den Demokraten John Kerry gerade auch wegen eines Vorsprunges um 25 Prozent, den Bush bei der Wählerschicht dieser weißen Männer hatte. Ein Hauptziel Barack Obamas war es, die "kulturelle Abkoppelung (Matt Bai im New York Times Mazine) der Demokraten vom Großteil solcher weißen Männer zu stoppen. Deshalb ging er in den letzten Wochen vor allem in die alten Industriehochburgen Pennsylvania, Ohio, Indiana und Missouri und warb verbissen um das Wahlstimmensegment der weißen Arbeiterklasse. Damit schlug er die Republikaner auf ihrem eigenen Terrain.
In diesen heiß umkämpften "battle ground states" entschied sich der Wahlkampf 2008, das leitet wohl eine fundamentale Wende in der US-Politik ein. McCains Antwort auf Obamas kühne Herausforderung war Samuel J. Wurzelbacher vulgo "Joe the Plumber" (auf gut österreichisch etwa "Joschi der Installateur"). In einer der bizarrsten Wenden neuerer amerikanischer Wahlkampftaktik machten McCain und seine Vizepräsidentschaftskandidatin Sarah Palin "Joe den Klempner" aus Ohio zur Ikone des Wahlkampfes. Bei einem Wahlkampfauftritt in Ohio fragte Joe den Kandidaten Obama, ob dieser seine Steuern erhöhen werde, falls er selbst eine Firma kaufen würde, die eine viertel Million Umsatz macht. Obama will nämlich Einkommen über 250.000 Dollar im Jahr höher besteuern als George W. Bush dies tat. Gleichzeitig will Obama Mittelklasse-Einkommen unter dieser Grenze Steuererleichterungen verschaffen. Obama antwortete "Joe the Plumber", er wolle "den Reichtum verteilen" ("spread the wealth around"), er wolle eine gerechtere Einkommensverteilung.
Das war das Startsignal für McCain, Obama wegen seiner Pläne als "sozialistischen Verteiler" zu verdammen. Palin ging noch einen Schritt weiter und sprach von "unamerikanischen" Plänen und zweifelte gar den Patriotismus derjenigen Amerikaner an, die "blau" (= Demokratisch) wählen. Damit wurden die Ressentiments zwischen den Klassen geschürt. Am Ende des Wahlkampfes wurde die "Joe the Plumber"-Geschichte immer bizarrer und schadete dem McCain-Palin-Team.
Obama wollte aber nicht nur die Stimmen von weißen Arbeitern und kleinen Gewerbetreibenden den Republikanern nicht überlassen. Genauso heftig, wie er die urbanen Industriearbeiter bewarb, kämpfte er um die Stimmen der "Rednecks" (historisch die armen weißen Landarbeiter im tiefen Süden), entlang der Appalachen-Bergkette in den Ostküste-Bundesstaaten North Carolina und Virginia sowie Kentucky, Tennessee und Westvirginia. Diese ländlichen Gegenden, wo die Männer viel Bier trinken und in ihre Schießgewehre und Trucks verliebt sind, leiden seit Jahrzehnten unter tiefer wirtschaftlicher Depression. Obama war der erste demokratische Präsidentschaftskandidat seit Jahren, der in diesen abgelegenen ländlichen Gebieten Wahlkampfstopps machte.
Keine Scheu vor Truck-Driver
Auch in traditionell Republikanisch-stimmenden westlichen Bundesstaaten wie Colorado, New Mexiko, Nevada, und selbst in McCains Heimatstaat Arizona gab sich Obama nicht von vornherein geschlagen. Auch hier - wo die Menschen noch einzelgängerischer und isolationistischer sind als im Rest der USA - warb er intensiv um Frauenstimmen (die Hillary Clinton-Wähler), weiße Männer (klassische "Marlboro"-Typen) sowie Hispanics (Latinos mit mittel- und südamerikanischen Wurzeln).
Abgesehen von Georgia und Florida engagierte er sich lediglich im tiefen Süden weniger intensiv. Das Gebiet von Texas bis South Carolina ist seit Richard Nixons Entfesselung der "silent majority" (stillen Mehrheit) 1968 zutiefst "rot" (= Republikanisch) geworden. Hier spielt die Rassenfrage unter den ärmeren weißen Schichten immer noch eine Rolle. Gerade hier erwarteten Experten vor der Wahl, dass der sogenannte Bradley-Effekt zur Geltung kommt (in Umfragen gibt man zwar an, den schwarzen Kandidaten zu wählen, tut es aber dann tatsächlich nicht).
Vielleicht aber gab gerade der umgekehrte Bradley-Effekt den Ausschlag für Obamas Erfolg. Gerade weil er so ein attraktiver, eloquenter, versöhnlicher Kandidat war, der mit einem ausgeglichenen Temperament die Wähler beeindruckte, spielte die Persönlichkeit eine weit größere Rolle als seine schwarze Hautfarbe.
Ein schwarzer Präsident ist ein Traum, den die meisten Afro-Amerikaner seit der Bürgerrechtsrevolution der 1960er Jahre nicht zu träumen gewagt haben. Ein schwarzer US-Präsident mit einem Elternteil aus Afrika ist für die gesamte farbige Welt ein Phänomen und gibt Aufwind. Es waren gerade die Erst- und Jungwähler, deren Stimmen Obama ins Weiße Haus hievten. Vielleicht sollte man es die "Revolte der politisch Desinteressierten und Politikverdrossenen" nennen - derjenigen, die sonst vom festgefahrenen politischen System gelangweilt sind. Ihre Stimmen für Obama gaben den Ausschlag. Aber auch überraschend viele zornige weiße Männer stimmten für Obama. McCains und Palins zynische "Joe the Plumber"-Strategie ging nicht auf. Die amerikanischen Wähler sind halt nicht so blöd, wie manche Republikaner meinten.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!