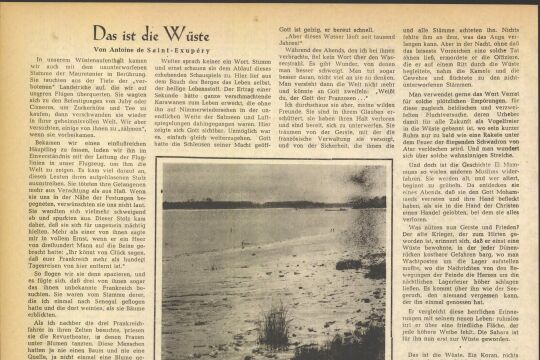Vor allem die von der Dürre betroffenen Nomaden werden von den Hilfsorganisationen unterstützt. Einblicke in das schwierige Leben in Kenia.
Jenseits vom überbordenden Luxus der "heilen Tourismus-Welt" Kenias, im District North Horr, im Norden des Landes: Ein seit Menschengedenken von Nomaden besiedeltes Wüstengebiet. Vereinzelt stehen hier kleine Haufen runder Verschläge aus dürren Dornenästen, braunen Tüchern und Fellen, ohne Strom und Wasser. In einem dieser "Nester" wohnt die Familie Jarso vom Volk der Gabbra auf etwa drei Quadratmeter: Ein verbeulter Topf, zwei Blechschüsseln, Tassen und ein Kochlöffel liegen um eine Feuerstelle. Zum Schlafen teilt sich die zwölfköpfige Familie zwei Betten. Auf einem davon sitzt Großvater Ali Jarso, ein 70-jähriger, magerer Mann mit sonnengegerbtem Gesicht.
Verlust um Verlust
Für Gabbra-Begriffe war Ali vor einem Jahr noch steinreich. Am Anfang der Dürre besaß er 600 Schafe und Ziegen und 60 Kamele. Aber in den vergangenen Monaten verlor er den größten Teil seiner Tiere: Seine Schafe, Ziegen und sogar die zähen Kamele, Nahrungs-und Transportmittel und wichtiges Statussymbol der Gabbra, sind gestorben. Ihre Kadaver verwesen zwischen den Hütten.
Der größte Verlust für Ali Jarso sind seine Kamele. "Die nächste Wasserstelle ist zehn Kilometer entfernt. Ohne Kamele ist es wirklich sehr schwierig für uns, das Wasser zu transportieren", klagt der hohlwangige Mann. Nur fünf Schafe und Ziegen sind Ali noch geblieben. Sie sind ausgezehrt und schwach.
Die erste Regensaison wurde bereits für Ende März erwartet. Vereinzelt hat es auch bereits geregnet, da und dort recken sich frische Grashalme aus dem kargen Boden rund um North Horr. Doch noch sind die wenigen Schauer nicht mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein: "Meine Tiere sind so schwach, dass sie sich nicht wieder vermehren können und auch keine Milch für die Familie geben", ist Ali verzweifelt.
"Nach der vergangenen Trockenperiode können auch normale Niederschläge nicht mehr sofort helfen", erklärt Sabine Wartha, die Katastrophenhilfe-Leiterin der Caritas Österreich. "Angenommen, es regnet jetzt richtig, dauert es noch mindestens ein Jahr, bis sich die Menschen von der Krise erholt haben und wieder selber ernähren können." Die Nomaden werden noch im kommenden Jahr Nahrung und andere Hilfe brauchen, appelliert auch die UNO.
Die Hoffnung bleibt
In Nairobi, der Hauptstadt Kenias, hört man immer wieder: "Warum lassen die Nomaden in Dürrezeiten ihr verbleibendes Vieh lieber sterben, als es rechtzeitig zu verkaufen und vom Erlös zu leben?" Bei Gesprächen mit Nomaden wird schnell klar: Je schwerer die Zeiten, desto mehr Tiere schaffen sie sich an. Und die Hoffnung auf Regen stirbt zuletzt. Auch Pater Toni hält diese Kritik für unberechtigt. Er leitet eine lokale Missionsstation im Norden, die von der Caritas unterstützt wird. "Die Kritik ist eine europäische Sicht", sagt der Deutsche, der seit zehn Jahren in Afrika lebt. Die Tiere erfüllen für die Familien nicht nur ihren eigentlichen Zweck als Nahrungsgrundlage durch Milch und Fleisch, sondern sind auch Statussymbol. Kamele werden für Stammesrituale gebraucht, vor allem aber, um hohe Brautpreise zu entrichten.
"Die Menschen leben hier noch wie vor hunderten Jahren", erklärt Wartha. Die Hirtenvölker haben ihre Art der Viehzucht wenig geändert. Aber die Welt um sie hat sich stark geändert. Es gibt weniger Weideland, dafür mehr Dürren. "Sie müssen umdenken und lernen, auch in ökonomischen Strukturen zu handeln", ist Pater Toni überzeugt. "Aber wie soll man das den Nomaden vermitteln, die es geschafft haben, hier seit Jahrhunderten zu überleben?" Die Regierung bietet keine Aufklärung an. "Aber ohne Bildung ist es sehr schwer, etwas zu verändern", erklärt Sabine Wartha, "die Grundschule kostet zwar nichts mehr, aber aufgrund der Abgeschiedenheit haben viele keinen Zugang zu Bildung."
Der Verkauf des Viehs ist derzeit auch keine Alternative für die Nomaden. "Durch den schlechten Zustand der Tiere ist der Preis am Viehmarkt deutlich gefallen", erzählt Ali Jarso. Seit der Dürre ist er deswegen auf Lebensmittel-Hilfe angewiesen. Von der Caritas bekommt Jarso für seine Familie neun Kilogramm Mais und Bohnen pro Monat. Denn die Regierung Kenias unternimmt nur sehr wenig, um den Betroffenen zu helfen.
"Der Mais, den wir von der Regierung erhalten, reicht nicht aus. Und wir bekommen nicht einmal Milch für die Kleinkinder", klagt Alis Ehefrau Quato, die täglich zehn Kilometer zurücklegen muss, um Wasser zu holen.
Nachhaltige Hilfe
Die Caritas-Helfer in North Horr sind täglich mit dem Leid der Menschen konfrontiert. "Es ist sehr schwierig, genug Nahrungsmittel zu bekommen, um die Familien für längere Zeit zu unterstützen", erzählt Hillary Halkano, "die Hilfe, die wir bringen, reicht oft nicht einmal fünf Tage und dann haben die Menschen nichts mehr."
Das kurzfristige, effiziente Krisenmanagement mit ausreichenden Hilfslieferungen rettet momentan viele Leben. Doch Pater Toni versucht, die Situation der Menschen auch langfristig zu verändern und zu verbessern: "Wir versuchen, die Menschen dazu zu animieren, dass sie einen Teil ihrer Herden in guten Zeiten verkaufen, um in schlechten Zeiten mit dem Erlös über die Runden zu kommen."
Aber: "Die Straßen sind in einem sehr schlechten Zustand, das heißt, der Zugang zum Markt wird erschwert", erklärt Sabine Wartha. Sie setzt auf Dämme und darauf, die Wassersysteme zu verbessern. "Das ist aber auch eine Frage der finanziellen Mittel", sagt Wartha. Ostafrika sei eine "stille Krise" und Geld dafür zu bekommen sei "sehr, sehr schwierig".
Die Autorin ist freie Journalistin und war für die Caritas in North Horr/Kenia tätig.