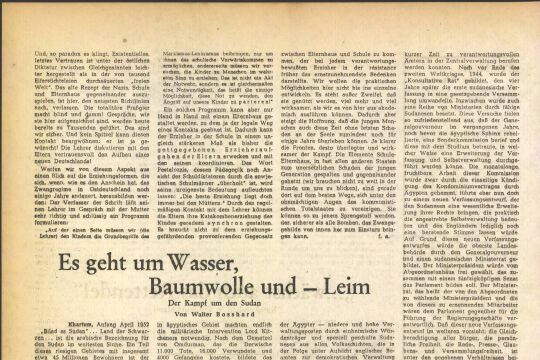Das UN-Ultimatum für die sudanesische Regierung läuft ab, und Khartum beeilt sich spät, aber doch, guten Willen zu zeigen. Doch der Flüchtlingsstrom reißt nicht ab, und die Regenzeit verhindert vielerorts das Vordringen der Helfer.
Die diplomatischer Friedensbemühungen zum Konflikt im westsudanesischen Darfur laufen auf Hochtouren: In der nigerianischen Hauptstadt Abuja verhandeln unter der Leitung der Afrikanischen Union Vertreter der sudanesischen Regierung und der beiden Rebellengruppen. Zuvor hat die sudanesische Regierung den Flüchtlingen aus Darfur in einer Vereinbarung mit den Vereinten Nationen die Rückkehr in ihre Heimat garantiert.
Die Heimkehr wird kein leichter oder schneller Prozess werden, sagte Brunson McKinley, der Generaldirektor der Internationalen Organisation für Migration der UN. Mittlerweile haben nach Schätzungen internationaler NGOs über 160.000 Menschen die Grenze in Richtung Tschad überquert. Über eine Million Menschen irren als Vertriebene durch den Sudan.
Die sudanesische Regierung gab außerdem das Zugeständnis, die Zahl der paramilitärischen Einheiten, die in Darfur operieren, um dreißig Prozent zu verringern. Die Freiwilligentruppe Popular Defence Forces wurde in den frühen 90er-Jahren gegründet und im Kampf gegen Rebellen eingesetzt. Seit das islamistische Militärregime mit den Rebellen der SPLA, die seit 1983 um eine Autonomie des Südsudan kämpften, einen Friedensvertrag aushandeln konnte, wurden sämtliche frei gewordenen militärischen Ressourcen in den Westen, nach Darfur, verlegt, um dort jeden Widerstand zu brechen.
Von den Nomaden profitiert
Darfur liegt am Südrand der Sahara und verfügt mit dem Gebirgsstock des Gebel Marra über ein mit Wasser versorgtes fruchtbares Gebiet, das permanenten Bodenbau erlaubt. Seit Jahrhunderten zogen die in den weiter nördlich gelegenen Trockensavannen lebenden arabisierten Nomadenstämme während der Trockenzeit mit ihren Herden in den Süden. Dabei kam es zwar immer wieder zu Konflikten mit den dort ansässigen nichtarabischen Bodenbauern, allerdings auch zu Handelsbeziehungen und kulturellem Austausch. Die sesshafte Bevölkerung, die schon seit Jahrhunderten den Islam angenommen, aber ihre lokalen Sprachen bewahrt hatte, profitierte durchaus von den arabischen Nomaden. Dieses Verhältnis änderte sich erst durch die ökologischen Probleme am Südrand der Sahara und das Eingreifen der Zentralregierung zu Gunsten der Nomaden.
Kampf ums Wasser
Bereits geringfügige globale Klimaverschiebungen führen am ökologisch sensiblen Südrand der Sahara zu einem großflächigen Vordringen der Wüste. Im Laufe der 90er-Jahre trockneten jährlich neue Brunnen aus. Dadurch kam es häufig zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Nomaden und Bodenbauern. Meist zogen zweitere den Kürzeren, da die Nomaden bereits unter der demokratisch gewählten Regierung Sadiq al-Mahdis in der zweiten Hälfte der 80er-Jahre mit modernen Waffen gegen die südsudanesischen Rebellen der SPLA versorgt worden waren. Diese Waffen kamen nun auch in den Wasserkonflikten in Darfur zum Einsatz.
Ohne das Zutun der Regierung wären die Auseinandersetzungen jedoch niemals derartig eskaliert. Das islamistische Militärregime unter Umar al-Bashir, das sich 1989 mit einem Putsch gegen Sadiq al-Mahdi an die Macht gebracht hatte, betreibt eine rücksichtslose Islamisierungs- und Arabisierungspolitik. Auch Bevölkerungsgruppen, die zwar seit Jahrhunderten islamisch, nicht jedoch arabisiert sind, wie die sieben Millionen Einwohner Darfurs, die Beja am Roten Meer oder die Nubier im Norden des Landes, werden marginalisiert. Die immer weiter verarmende (nichtarabische) Peripherie profitierte nicht vom ökonomischen Aufschwung der (arabischen) Zentren, die durch Erdöleinnahmen zu gewissem Wohlstand gekommen waren. Allerdings profitierte auch unter der arabischen Bevölkerung nur eine Minderheit vom Öl und der Privatisierungspolitik der Regierung. Im Wesentlichen rissen sich Parteigänger der Islamisten die ehemals staatlichen Firmen unter den Nagel und machten mit ihren "islamischen Banken" das große Geschäft. Auch Osama Bin Laden erhielt Mitte der 90er mit seiner Firma al-Hijra Construction and Development Co. Ltd. Großaufträge. Aber auch österreichische Firmen wie die OMV schnitten mit. Kein Wunder, dass sich zum zwölften Jahrestag des Militärputsches im Juni 2001 auch Fritz Edlinger, Generalsekretär der Gesellschaft für Österreichisch Arabische Beziehungen (GÖAB), persönlich als Gratulant in Khartum einstellte.
Im Fadenkreuz der USA
Tatsächlich brachte die neoliberale Wirtschaftspolitik dem Land makroökonomische Erfolge. Der Internationale Währungsfond (IWF) honorierte dies, indem er 1995 den Status des Sudan als "unkooperativ" aufhob. Die sudanesische Regierung konnte Ende der 90er erstmals seit über einem Jahrzehnt aus eigener Kraft die vereinbarten Zahlungen an den IWF begleichen. Ein großer Teil der Einnahmen aus dem Ölgeschäft und der Privatisierung ging jedoch in militärische Infrastruktur und die Förderung islamistischer Gruppierungen im Ausland. Erst unter dem Druck der USA wurden offensichtliche Verbindungen zu islamistischen Terrorgruppen gekappt. Seit dem internen Sturz des islamistischen Chefideologen Hasan al-Turabi im Herbst 1999 versucht sich die Regierung in einem Drahtseilakt zwischen islamistischer Realpolitik und außenpolitischem Wohlverhalten, um nicht selbst in das Fadenkreuz des "Kriegs gegen den Terror" zu geraten.
Dass sich in der sudanesischen Innenpolitik letztlich wenig geändert hat, zeigt die Entwicklung in Darfur. Die bewaffneten Nomaden wurden zu gut trainierten Milizen, den Dschandschawid, ausgebildet. Seit sich im Februar 2003 die Darfur Liberation Front (DLF), die sich wenig später in Sudan Liberation Movement (SLM) umbenannte und ihre Basis in der nichtarabischen Bauernbevölkerung Darfurs besitzt, zum bewaffneten Kampf gegen die Zentralregierung entschlossen hat, werden die Dschandschawid von der Regierung mit logistischer und militärischer Unterstützung gegen die nichtarabische Dorfbevölkerung eingesetzt.
Die schlimmsten Massaker, denen ganze Dörfer zum Opfer gefallen sind und die mit einem hohen Maße sexueller Gewalt gegen Frauen einhergehen, werden dabei den Dschandschawid überlassen, für die sich die Regierung - die den Konflikt als ethnischen Bürgerkrieg darstellt - als nicht verantwortlich sieht. Dabei bombardieren Regierungstruppen den Dschandschawid den Weg frei. Die Angehörigen der Miliz werden von Regierungstruppen trainiert und kämpfen teilweise in Uniformen der sudanesischen Armee. Für Kenneth Roth, Direktor von Human Rights Watch, ist klar: "Die Dschandschawid können als von der sudanesischen Regierung unterstützte Milizen bezeichnet werden. Diese Milizen arbeiten gezielt mit Regierungstruppen zusammen und können mit Straffreiheit für ihre massiven Verbrechen rechnen."
Das UN-Ultimatum läuft ab
Als zeitgleich mit den Friedensverhandlungen im Südsudan mit dem Justice and Equality Movement (JEM) noch eine zweite Guerillabewegung auf den Plan trat, nahmen die Vertreibungen und Massaker durch die Dschandschawid ein epidemisches Ausmaß an. Mittlerweile hat die sudanesische Regierung erstmals Kontakte zu den arabischen Reitermilizen in Darfur zugegeben und eine Liste mit Dschandschawid-Kämpfern vorgelegt. Der Grund für die Kooperation ist schnell erklärt: Für die Regierung in Khartum wird die Zeit knapp. Ende August läuft das UN-Ultimatum zur Entwaffnung der Reitermilizen ab.
Der Autor ist Politikwissenschafter in Wien und hat kürzlich im Peter Lang Verlag seine Studie über die ArbeiterInnenbewegung im Sudan veröffentlicht.