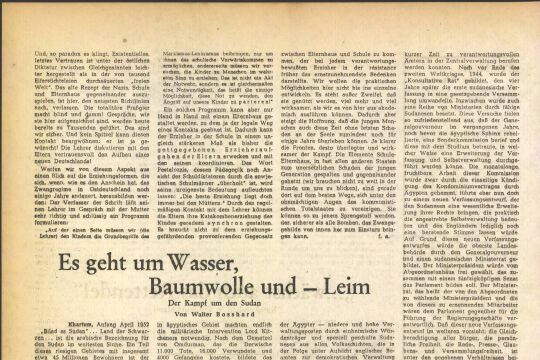Frieden im Sudan: Nach zwei Jahrzehnten verlustreichem Bürgerkrieg zwischen dem Norden und Süden des Landes wurde im Jänner dieses Jahres ein Friedensabkommen geschlossen. Doch das Morden in Afrikas flächenmäßig größtem Staat geht weiter, der Kriegsschauplatz hat sich bloß vom Süden in den Westen verlagert. Und auch in diesem Konflikt in West-Darfur sollen blutig ausgetragene ethnische Gegensätze zwischen "Arabern" und "Afrikanern" nur den Streit um die Ölvorkommen in der Region verschleiern. Redaktion: Wolfgang Machreich Niedergebrannte Dörfer und Massaker sonder Zahl - 1896, als Karl May den Sudan beschreibt und 2005, als die uno nach Beweisen für einen Genozid sucht.
Hamdulillah, es geht los!" rief einer unserer Bewacher in freudigem Ton. "Die Ratten werden ausgeräuchert." - "Wollt ihr sie verbrennen?" fragte ich entsetzt. "Verbrennen!" lachte er. "Du weißt also nicht, wie es bei einer Sklavenjagd zugeht?" Ich gab keine Antwort, sondern zermarterte mir indes das Gehirn mit der Frage, ob es nicht möglich sei, die armen Schwarzen zu retten, sie wenigstens zu warnen."
Doch Kara Ben Nemsi liegt gefesselt am Boden und muss hilflos zusehen, wie "Schwarze" von "Arabern" gefangen genommen und in großer Zahl getötet werden. 1896 hat Karl May den dritten Band seines Reiseabenteuers "Im Lande des Mahdi" veröffentlicht, doch seine Beschreibung des Überfalls eines Dorfes im Sudan ist von beklemmender Aktualität:
"Du weißt, dass die Negerdörfer von hohen Stachelzäunen umgeben sind. Die Dornen sind vertrocknet und brennen gut. Sobald man das Dorf umzingelt hat, zündet man den Zaun an. In einigen Minuten lodert es überall; die Funken fliegen auf die Negerhütten, die sofort in Brand geraten. Die Schwarzen erwachen, wollen sich retten. Draußen ist es dunkel; sie sind geblendet und sehen nicht, wer und was sie vor sich haben; sie werden ergriffen und gefesselt. Wer sich wehrt, wird niedergestochen, erschossen und erschlagen. Und indem man solche unbrauchbare Schwarze in das Feuer zurücktreibt, spart man das Pulver, das sie nicht wert sind." - "Schweig mit deiner Beschreibung", rief in dem Moment mein treuer Gefährte Ben Nil. "Ihr seid keine Menschen, sondern Teufel!"
"Teufel auf Pferden"
"Janjaweed" heißen die heutigen "Teufel auf Pferden" und ihre Übergriffe auf die Menschen in Darfur werden wie in Karl Mays Abhandlung von einer Rhetorik begleitet, die sich der rassistischen Kategorien "Arab" und "Zurq" (Schwarzer) oder "Abid" (Sklave) bedient. Sudan-Kenner Sean O'Fahey kommt in der International Herald Tribune zum Schluss: "Viele der rassistischen Gesinnungen, die traditionell gegen Sklaven gerichtet waren, wenden sich nun gegen sesshafte nicht-arabische Gemeinschaften."
Laut Bericht des un-Untersuchungsausschusses zum Sudan von Anfang Februar dieses Jahres erfüllen die Vorgänge in Darfur jedoch nicht den rechtlichen Tatbestand des Völkermords. Es komme allerdings fortgesetzt zu schweren Menschenrechtsverletzungen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Der Sudan-Ausschuss erwähnt in seinem Bericht "Elemente von Genozid": Bestimmte Volksgruppen würden gezielt verfolgt und vertrieben und solche Verbrechen seien "nicht minder schwerwiegend als ein Völkermord". Dennoch vermeidet die uno in ihrem Bericht den expliziten Vorwurf des Genozids an Khartum - "weil ansonsten der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen unter erheblich stärkerem Druck geraten wäre, dem Morden ein Ende zu bereiten", kritisieren Menschenrechtsorganisationen und Staatskanzleien, unter anderem die der usa, die sich alle für ein härteres Vorgehen gegen das sudanesische Regime einsetzen.
Alle sind gleich schwarz
Und während der Streit um die Definition weitergeht, ob in Darfur gerade ein Völkermord stattfindet oder nicht, geht auch das Töten weiter. Doch nicht einmal alle Miltärkommandeure in Darfur würden verstehen, um was es bei ihren Kämpfen eigentlich geht, ist Alex De Waal überzeugt. Ein Krieg zwischen "Arabern" und "Afrikanern", der Kampf um natürliche Ressourcen, das Aufbegehren einer vernachlässigten Region gegenüber dem Gesamtstaat - diese üblichen Beschreibungen des Konflikts in Darfur enthalten alle ein Stück Wahrheit, meint der Direktor von Justice Africa mit Sitz in London, "aber zugleich führen sie in die Irre".
De Waal schreibt in einem Beitrag für Le monde diplomatique, dass die "Araber" von Darfur genauso schwarz und eingeboren seien wie ihre Widersacher und es außerdem immer schon Heiraten zwischen den Angehörigen beider Gruppen gab. Hinzu kommt, dass alle Bewohner Darfurs Muslime sind. Auch Konflikte über Wasserrechte und Grundbesitz habe es in Darfur seit jeher gegeben, "doch ein organisierter Krieg" aus diesem Grund wäre neu. Genauso erkläre auch die mangelnde ökonomische Entwicklung der Provinz Darfur das Ausmaß der Feindseligkeiten zwischen arabischen und nichtarabischen Gruppen nicht, meint De Waal, "denn beide Interessen wurden gleichermaßen vernachlässigt". Bleibt angesichts abgebrannter Dörfer, Massaker und Massenvergewaltigungen die Frage: "Warum wurden manche Leute in Darfur zu Killern?"
Axel De Waals Antwort fällt sehr differenziert aus, verweist auf die Grautöne, meidet eine holzschnittartige Einteilung in Gute und Böse, denn "die mörderischen Aktionen der Janjaweed dürfen die Tatsache nicht verdecken, dass die indigenen arabischen Nomaden von Darfur in der Vergangenheit selbst zu Opfern wurden - dass man sich an den Sündern selbst versündigt hat".
Sind die Janjaweed demnach Opfer, die jetzt zu Tätern werden? Ausgelöst habe die Etikettierung in "Araber" und "Afrikaner" der lybische Staatschef Muammar al-Gaddafi, der vor 20 Jahren von einem "arabischen Gürtel" quer durch die Sahelzone träumte, erklären Sudan-Experten in verschiedenen Publikationen. Gaddafi sammelte damals die Unzufriedenen in der Region und fasste sie zu einer bewaffneten "Islamischen Legion" zusammen. Nach einer vernichtenden Niederlage durch tschadische Regierungstruppen 1987 ließ Gaddafi seine hochfliegenden Pläne fallen. Doch die Kämpfer der Legion - gut ausgebildet, gut bewaffnet und von einem arabischen Überlegenheitsanspruch erfüllt - lösten sich nicht in Luft aus. Sie betrieben ihre Mission weiter - unter wechselnden Anführern, in verschiedenen Konflikten. Für Olaf Köndgen, den früheren Projektassistenten der Konrad-Adenauer-Stiftung in Kairo, sind die vielen von der westlichen Öffentlichkeit nicht wahrgenommenen Regionalkriege im Darfur der 90er Jahre "die Vorläufer des heutigen Konflikts". Deswegen wundert es ihn nicht, dass viele der Schusswaffen, die man heute in Darfur findet, von den rivalisierenden Truppen der letzten Jahrzehnte stammen.
Nachdem die sudanesische Zentralregierung Anfang 2003 schwere Niederlagen gegen die aufständischen Befreiungsarmeen in Darfur einstecken musste, soll Sudans Staatspräsident Omar Hassan al-Bashir auf eine bereits im Süden des Landes erfolgreiche Form der Aufstandsbekämpfung zurückgegriffen haben: eine Strategie der verbrannten Erde und der damit einkalkulierten Hungersnöte. Die Aufständischen sollten damit ihrem Nachschub an Kämpfern und der Unterstützung aus der Bevölkerung verlustig gehen. Im Falle Darfurs boten sich für diese Rolle die verbitterten früheren Kämpfer der islamischen Milizen an - und aus der arabischen Bezeichnung für das deutsche Gewehr G3 und dem Wort "dschawad" für Pferd, das im westsudanesischen Dialekt aber auch "Pöbel" bedeutet, wurden die Janjaweed. Und auch wenn es Khartum vehement bestreitet (siehe Minister Ahmed Bilal Osmane, Seite 23) ist für die große Mehrheit der Sudan-Spezialisten klar: "Die Janjaweed wurden in die Armee eingegliedert, und in den Gebieten der Aufständischen ließ man ihnen freie Hand." Der Sudan-Ausschuss der Vereinten Nationen nennt in seinem Bericht keine Namen von den mutmaßlichen Drahtziehern in der Regierung. Es soll aber eine vertrauliche Liste "möglicher Verdächtiger" geben, auf der Regierungsbeamte und Milizionäre, aber auch Rebellen und "sogar ausländische Offiziere" stehen. Diese Liste, heißt es, wurde un-Generalsekretär Kofi Annan seperat übergeben.
Wie damit weiter verfahren wird, ist unklar. Der uno-Ausschuss empfiehlt, den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag einzuschalten. Die usa, die einerseits dieses Gericht ablehnen, sich andererseits als prononcierteste Befürworter einer härteren Gangart gegen das Regime in Khartum hervortun, plädieren für einen Ad-hoc-Gerichtshof wie im Fall von Ruanda oder Jugoslawien. Doch daneben gibt es immer noch eine Reihe von Ländern im Sicherheitsrat, die Omar Hassan al-Bashir die Stange halten - nicht ganz uneigennützig.
Letztes Jahr hat eine von der China National Petroleum Corporation gebaute Pipeline den Betrieb aufgenommen, die Öl aus Süd-Darfur und dem angrenzenden West-Kordofan nach Khartum pumpt. Und für die noch nicht erschlossenen Konzessionen in Nord- und West-Darfur stehen bereits Interessenten aus Russland, Japan, Bulgarien, Rumänien und Irland bereit. Die Aufhetzung verschiedener Volksgruppen und die nachfolgende Vertreibung in Darfur ist für die Menschenrechtsorganisation "Human Rights Watch" deswegen vor allem eine Möglichkeit zur Kontrolle der Ölproduktion. Eine Taktik, die schon in anderen Landesteilen angewendet wurde: Denn "war die Bevölkerung ausgedünnt, konnte die Regierung Sicherheitszonen um die ölproduzierenden Gebiete errichten, damit ausländische Ölgesellschaften in Ruhe und Sicherheit mit der Förderung beginnen konnten, während jene, die seit Generationen auf dem Land gelebt hatten, Frieden Sicherheit, Heimat, Tiere, Ernten, Familien und oft ihr Leben verloren haben".