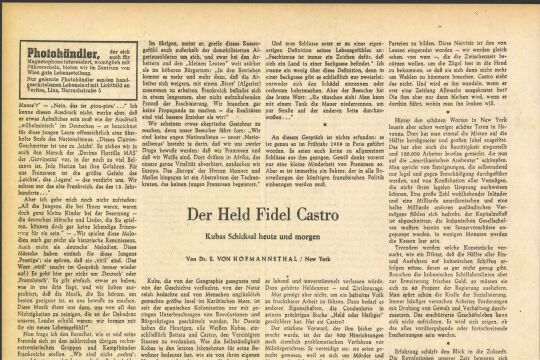Eine Armee der weißen Kittel
Für Kuba gehören Ärzte zu den wichtigsten Exporten. Offiziell, um die Gesundheitsversorgung ärmerer Länder zu verbessern. Doch das Land erhofft sich auch diplomatische Vorteile -und spielt damit Milliarden in die Staatskassen.
Für Kuba gehören Ärzte zu den wichtigsten Exporten. Offiziell, um die Gesundheitsversorgung ärmerer Länder zu verbessern. Doch das Land erhofft sich auch diplomatische Vorteile -und spielt damit Milliarden in die Staatskassen.
Schon frühmorgens ist es heiß in Changuinola, einer 30.000-Einwohner-Stadt im westlichsten Teil Panamas. Tania González ist auf dem Weg zu ihrem Arbeitsplatz, dem Hospital Raul Davila Mena, wo sie als Allgemeinmedizinerin tätig ist. "Außer Bananenplantagen gibt es hier nicht viel. Die Bevölkerung ist arm und lebt von der Landwirtschaft", erzählt Tania. Trotzdem mag sie das Leben hier. Mit einfachen Bedingungen zurechtzukommen, das hat sie in Kuba gelernt. "Als ich klein war, erzählte mir mein Vater eine Geschichte: Wenn in Kuba jemand eine Münze auf der Straße findet, dann legt er eine zweite dazu anstatt die Gefundene einzustecken. Warum? Weil er denkt, man sammelt dort am Boden Geld für jemanden, der es nötig hat."
Schon früh war es ihr Traum, eines Tages auf Kuba zu leben. Sie fasste den Entschluss, sich für ein begehrtes Stipendium zu bewerben, um auf der Insel Humanmedizin zu studieren. Sie erhielt es. Studiengebühren, Unterkunft, Verpflegung und Taschengeld - alles wurde bezahlt. Nicht etwa von ihrem Heimatland Panama, sondern vom weit ärmeren Inselstaat.
Kubas "humanistische Mission"?
Das kommunistische Land vergibt Stipendien an ausländische Medizinstudenten aus über 80 Ländern, vorrangig in Lateinamerika und Afrika. Offizielles Ziel ist es, die Gesundheitsversorgung selbst in den ärmsten Regionen der Welt zu verbessern. Das politisch isolierte Land will sich mit dieser Strategie zudem diplomatische Unterstützung der Partnerstaaten sichern. Auch eigene Ärzte bildet Kuba aus. Gab es vor der Revolution nur rund 6000 im Land, sind es heute 90.000. Knapp ein Viertel von ihnen arbeitet im Ausland, allerdings verpflichtend für den kubanischen Staat. Als humanistische Mission bezeichnete der langjährige Staatschef Fidel Castro seine "Armee der weißen Kittel". Zugleich ist es aber auch eine Mission, die jährlich rund 11,5 Mrd. US-Dollar in die Staatskassen spült.
Die im Westen von Havanna gelegene "Escuela Latinoamericana de Medicina", kurz ELAM, ist eine der größten Medizinuniversitäten der Welt. Der Campus in der einstigen Marineakademie liegt direkt am Meer und setzt sich aus schlichten, weiß-blauen Rechtecken zusammen, in denen heute Medizinstudenten aus aller Welt leben und lernen. Hier bezog auch Tania ein Sechsbettzimmer im Studentenheim. Unterrichtet wurde sie dort von der "Crème de la Crème", wie sie erzählt. Tania lernte Tag und Nacht. Sport-und Kulturveranstaltungen fanden am Universitätsgelände statt, das die Panamaerin damals kaum verließ. "In dieser Zeit habe ich ständig gedacht, dass das Studium nichts für mich sei", erinnert sie sich. Schließlich wollte Tania ursprünglich gar nicht Ärztin werden, sie wollte einfach nur auf der fernen, unbekannten Insel aus den Kindheitserzählungen ihres Vaters leben. Das Land sollte sie aber erst später kennenlernen.
Der Deal war für Tania als Nicht-Kubanerin ein weit besserer als für einheimische Ärzte. Zwar ist auch für Kubaner die Ausbildung kostenlos, einen Preis zahlen sie aber sehr wohl dafür. Denn nach dem Studium beträgt das übliche Arztgehalt zwischen 30 und 45 US-Dollar im Monat. Viele von ihnen arbeiten nebenbei als Kellner oder Mechaniker oder sie gehen für den Staat ins Ausland. An über 60 Länder entsendet Kuba Ärzte auf Mission. Die reicheren Staaten, darunter Saudi-Arabien, China und Südafrika bezahlen dafür. Einige ärmere wie Haiti, Bolivien oder der Kongo bekommen die medizinische Unterstützung gratis.
Spannungsfeld Kuba-USA
Zudem haben Bewerber aus ärmeren Ländern eher Chancen auf ein Stipendium an der ELAM, wie es Tania bekommen hat. In ihrem Jahrgang gab es jedoch auch Exoten: US-Amerikaner. Keiner von ihnen konnte zu Ende studieren und Tania kennt den Grund dafür. "Nach zwei Jahren Studium haben die USA ihnen mitgeteilt: Entweder ihr brecht ab und kommt sofort zurück oder ihr müsst bei eurer nächsten Einreise in die USA 10.000 Dollar Strafe zahlen. Nach diesem Ultimatum hat es in meinem Jahrgang keine US-Amerikaner mehr gegeben."
2006 trat unter dem damaligen Präsidenten George W. Bush das "Cuban Medical Professional Parole Program" in Kraft. Es richtete sich explizit an medizinisches Personal aus Kuba, das in einem Drittland tätig war. Ärzte, die gerade in Brasilien für den kubanischen Staat arbeiteten, konnten in den USA relativ einfach eine Aufenthaltsgenehmigung erlangen. Im Bemühen, die Beziehungen zu dem Karibikland zu verbessern, beendete Barack Obama während seiner Amtszeit das Programm.
Dabei war es für einige kubanische Ärzte in Brasilien die Ausstiegsstrategie aus der Mission "Mais Médicos", zu Deutsch "Mehr Ärzte". Insgesamt soll Kuba rund 18.000 Mediziner in das südamerikanische Land geschickt und pro Arbeitskraft über 3.600 Dollar monatlich erhalten haben. Bis heute bekommen die Ärzte nur ein Viertel davon als Gehalt ausbezahlt, zudem müssen sie sich für drei Jahre verpflichten. Als "Sklavenarbeit" bezeichnet das die kubanische Missionsärztin Yaili Jiménez Gutierrez, die letztes Jahr genau wie viele ihrer Kollegen in Brasilien gegen ihren Arbeitsvertrag klagte. Kuba reagierte hart: Yaili verlor ihren Job und darf ihr Heimatland für acht Jahre nicht betreten.
Lektion in Menschlichkeit
Auch Tania musste sich im Rahmen ihres Stipendiums zu einem "Pacto de Honor" verpflichten. Sie sollte nach der Ausbildung für mindestens zwei Jahre in einer Problemregion in Panama arbeiten. Ein Leben lang als Ärztin zu arbeiten, konnte sie sich nach zwei Jahren in Havanna zwar noch immer nicht vorstellen, über medizinisches Wissen verfügte sie aber. Dann brach das dritte Jahr an und damit die praktische Ausbildung. Von nun an besuchten die Studenten nicht mehr den Hörsaal in Havanna, sondern Krankenhäuser in der Provinz. Dort machte Pedro Tania zur Ärztin. Er war ihr erster Patient.
"Ich habe mich sofort in ihn verliebt. Er hatte Lungenkrebs, sich aber standhaft geweigert mit dem Rauchen aufzuhören. Pedro war einfach ein alter, unheimlich netter, aber einsamer Mann."
Mit ihm lernte Tania ihre wichtigste Lektion im Medizinstudium: Menschlichkeit. Danach war es für sie klar: Sie wollte Ärztin werden.
Trotz der unterschiedlichen Erfahrungen mit dem System praktizieren Ärzte mit kubanischer Ausbildung, wie Tania und Yaili, alle nach einer Regel: Ohne den Menschen und sein soziales Umfeld zu kennen, kann er nicht erfolgreich behandelt werden. Dafür braucht es Zeit, die sich kubanische Ärzte bewusst nehmen, die aber im Gegensatz dazu bei ihren westlichen Kollegen oft Mangelware ist. Fest steht, nicht alle profitieren gleich viel von Kubas Ärztesystem. Fest steht aber auch, weltweit hat es Hunderttausende Menschenleben gerettet, gerade bei Katastropheneinsätzen. So wurden nach dem verheerenden Erdbeben in Haiti im Jahr 2010 etwa 40 Prozent der Verletzten von kubanischen Ärzten behandelt. Und auch Tania hat mittlerweile unzähligen Patienten geholfen. Vor zehn Jahren schloss die Panamaerin ihr Medizinstudium ab und ging zurück in ihr Heimatland, um, wie von der kubanischen Regierung gefordert, als Ärztin in einer vernachlässigten Region zu arbeiten. Heute tut sie das in Changuinola immer noch mit Leidenschaft.