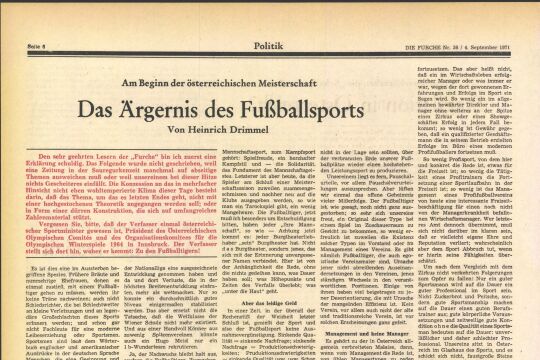Der Handel mit talentierten Nachwuchskickern aus Afrika floriert. Doch statt eines Durchbruchs an die Spitze folgt für viele der soziale Einbruch.
Jean-Claude Lagaisses Augen glänzen, wenn er vom Afrika Cup spricht. Für seine Branche, sagt der Fußballer-Vermittler aus dem flämischen Roeselare, ist die Kontinentalmeisterschaft, die letzten Sonntag mit dem Sieg Ägyptens zu Ende gegangen ist, ein Großereignis. "Der Afrika- Cup hat inzwischen ein sehr hohes Niveau", sagt Lagaisses, "das bedeutet natürlich ein allgemeines Scouting der Spieler, die noch nicht in Europa sind." Scouts, das sind Talentespäher, die für europäische Clubs, aber auch für Agenten wie Lagaisse die Welt nach jungen, hungrigen und vermarktbaren Kickern durchkämmen. Früher machten ehemalige Spieler das nebenberuflich. Inzwischen besteht ein weit verzweigtes Netzwerk professioneller Späher.
Lagaisses Firma, eins der größten Fußballer-Maklerbüros in Belgien, arbeitet mit fix angestellten Scouts in afrikanischen Ländern. In Nigeria sitzt der Kontaktmann direkt im Fußballverband, da ist der Transfer von Fußballtalenten nach Europa keine Frage. Dass in den letzten 20 Jahren viele davon in Belgien gelandet sind, ist kein Zufall. Schon nach drei Jahren Aufenthalt erhalten Fußballer die belgische Staatsbürgerschaft. Zudem kennt die belgische Liga, anders als in den anderen großen Ligen Europas, keine Obergrenze für Spieler von außerhalb der EU. Man sieht das an den Kadern, die gespickt sind mit westafrikanischen Namen.
Im Dutzend Spieler geholt
Dass der billige Import und teure Export talentierter Kicker eine Goldgrube ist, hat sich schnell herumgesprochen. Berichte machten die Runde über Agenten, die junge Afrikaner im Dutzend holten, die Guten verkauften und den unglücklichen Rest in der Illegalität zurückließen - denn auch in Belgien führt der Weg zur Arbeitsgenehmigung nur über einen Profivertrag. Vor ein paar Jahren hatte der belgische Verband genug und führte einen Mindestlohn für nicht-europäische Spieler ein: 475.000 Euro im Jahr, was noch immer deutlich unter dem Niveau dessen liegt, was Profi-Fußballer in den Niederlanden verdienen. "Das ist nichts", lacht Lagaisse, der selbst Wert auf Seriosität legt, den Sumpf trockne man damit nicht aus. Und so blieb Belgiens unscheinbare Liga die "Etalage", die Fußballer-Ausstellung Europas, das Sprungbrett in Fußball-Schlaraffenländer wie England, Italien oder Spanien.
Vermitteln, verkaufen …
Und weitere Geschäftsideen wurden geboren: Immer mehr belgische Clubs unterhalten Kooperationsverträge mit niederländischen oder englischen Vereinen. Ajax Amsterdam, Feyenoord Rotterdam, Manchester United, Chelsea … - alle vermitteln ihrem außereuropäischen Nachwuchs bei belgischen Partnervereinen Spielpraxis und einen EU-Pass, um das Ausländerkontingent nicht zu belasten.
Bekanntestes Beispiel ist der KSK Beveren in der Peripherie Antwerpens, der fünf Jahre lang das Scharnier zwischen der Elfenbeinküste (Cote d'Ivoire) und Europas Fußballadel bildete. Auf der einen Seite stand das ivoirische Spitzenteam ASEC Mimosas in Abidjan, das Beveren jährlich Spieler schickte. Auf der anderen das ruhmreiche Team Arsenal London, Liebling aller Fans des gepflegten Offensivspiels. Natürlich wurden die Kicker auch an andere Vereine weiterverkauft, doch einer der Drahtzieher saß in London: Arsenals Trainer Arsène Wenger. Sein Partner war der französische Ex-Nationalspieler Jean-Marc Guillou, der in Abidjan eine Fußball-Akademie betreibt. Deren Absolventen wurden an ASEC Mimosas vermittelt, wo Guillou zwischenzeitlich auch verschiedene Funktionen innehatte, und von dort nach Beveren.
… vertuschen, verschieben
Ein paar Jahre lang lief das gut. "Wir hatten große Erfolge, konnten uns sogar für den Europacup qualifizieren, und wir hatten tolle Spieler. Den Zuschauern gefiel der technische Fußball, das kennen sie sonst nicht so hier", erzählt Dirk Verelst, der neue Vorsitzende des KSK Beveren. Er ist erst seit letztem Sommer im Amt, der ganze Verein wird umstrukturiert, neue Spieler, neuer Vorstand, denn man hat sich verhoben an diesem Abenteuer mit der Elfenbeinküste. Immer mehr Spieler kamen aus Abidjan, irgendwann waren es über 20, und die Mindestgehälter mögen für europäische Maßstäbe lächerlich sein, für Beveren, so Verelst, ging es über die finanzielle Schmerzgrenze hinaus.
Manche sagen, Guillou und Wenger hätten jeweils 45 Prozent der Einkünfte der profitträchtigen Dreiecksbeziehung eingestrichen. Verelst bestätigt, sein Verein habe nicht mehr als zehn Prozent verdient. "Damit ist der Club nie wirklich gut gefahren, das war natürlich eine bittere Pille." 2006 liefen die Verträge mit ASEC und Arsenal aus, doch Beveren, sagt Verelst, spüre bis heute die Nachwehen. 2007 stieg man in die Zweite Liga ab, die finanzielle Lage ist bedenklich, zudem steht noch ein Prozess mit Guillou ins Haus. Dennoch verliert der Vorsitzende kein schlechtes Wort über den Geschäftsmann. Im Gegenteil, er rühmt dessen Nase für Talente und würde gerne wieder mit ihm kooperieren. "Doch seine finanziellen Forderungen sind zu hoch." Im Moment steht Beveren ohne Partnerverein da, doch das soll sich bald ändern. "Für die kleineren Vereine ist das eine Überlebenschance. Wir haben wieder eine Anfrage aus England", sagt Verelst geheimnisvoll.
Die Zukunft kann kommen, und bleiben wird vorerst Alexander Takpo. Der junge Mittelfeldspieler ist einer der verbliebenen Ivoirer im Team: "Für mich ist Beveren kein Schaufenster", sagt er, "denn es gibt so viele gute junge Spieler in der Elfenbeinküste."
Ohne Vertrag vor dem Nichts
Für diejenigen, die in Europa keinen Profivertrag bekommen, sieht es düster aus. Das bedeutet einen Kampf ums Überleben ohne Arbeitserlaubnis, Sprachkenntnisse und Unterstützung, dafür mit der drohenden Illegalität im Nacken. Viele solcher Spieler sind bei Solange Cluydts vorstellig geworden. Sie arbeitet bei der Antwerpener Initiative "Payoke", die sich um die Opfer von Menschenhandel kümmert. In Belgien sorgt das Thema regelmäßig für Aufsehen. Es gibt Berichte über Fußball-Agenten, die afrikanische Nachwuchsspieler aussetzten, wenn sie diese nirgends unterbringen konnten oder wenn andere Probleme auftauchen. Cluydts erzählt von zwei Nigerianern, die zwar einen Vertrag besaßen, aber nicht volljährig waren. Bei einer Kontrolle flogen sie auf, standen schließlich mittellos bei "Payoke" vor der Tür. Mehrere Prozesse hat es in solchen Fällen bereits gegeben, allein verurteilt wurde noch niemand. "Und ich erwarte auch nicht, dass das passiert", sagt Cluydts, "auch wenn es in der Vergangenheit im Profifußball Fälle von Menschenhandel gegeben hat. Aber Fußball ist Ökonomie, und Auflagen werden umgangen."
Menschenhandel-Netzwerk
Dies beklagt auch Jean-Marie Dedecker, der vor fünf Jahren einem Ausschuss im belgischen Senat vorsaß - Thema: Menschenhandel im Geschäft mit afrikanischen Fußball-Talenten. Seitdem sind zwar Maßnahmen ergriffen worden, die reichen aber nicht aus. Die Gehaltsgrenze für Nichteuropäer ist zu niedrig, und was nützen die strengeren Kriterien für das Registrieren von Spielervermittlern, wenn diese über Unterhändler weiter ihre ausbeuterischen Praktiken betreiben?
Dedecker berichtet, dass nach wie vor gestrandete Jungkicker gelegentlich vor seiner Tür stehen. Dass sich die Lage kaum bessert, macht ihn mutlos. "Aber es handelt sich um ein Netzwerk aus Fußball, Justiz, bis in die höchsten Ebenen der Politik." Ein solches Geflecht bestätigt auch Spielervermittler Lagaisse. Jeder Club habe über Vorstand und Aufsichtsräte einen Minister im Boot. "Mafia? Na klar, das wird immer so bleiben. Ich selbst halte mich fern, aber verändert hat sich nichts. Sie finden immer ein Hintertürchen."
Der Autor ist freier Journalist in Amsterdam.