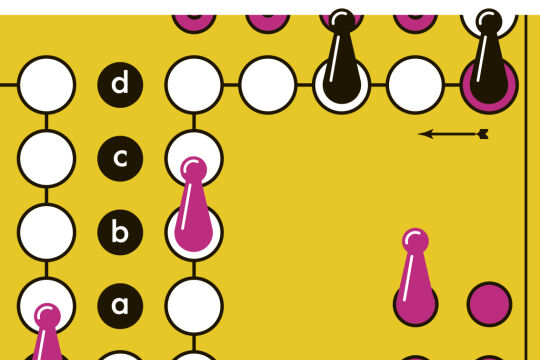Gezeichnet von der Euphorie
Im Überschwang und in der Depression zeigen die Märkte erst, was Ökonomie wirklich ist: ein menschliches Drama voll von Stimmungswechseln, urtümlichen Emotionen und Vorbildern, die bis in in den Garten Eden zurückreichen.
Im Überschwang und in der Depression zeigen die Märkte erst, was Ökonomie wirklich ist: ein menschliches Drama voll von Stimmungswechseln, urtümlichen Emotionen und Vorbildern, die bis in in den Garten Eden zurückreichen.
Ein fauler Schreiber könnte es sich an dieser Stelle einfach machen und den Beginn dieser Geschichte quasi volley von Martin Tauss übernehmen, der auf Seite 5 formuliert hat: "Was Stimmungen bewirken können, zeigt sich am ehesten in ihren Extremen. Der eine Pol ist die Depression ...". Der Faule bräuchte nur ein Wort hinzuzufügen: "Was ökonomische Stimmungen bewirken können, zeigt sich am ehesten an ihren Extremen. Der eine Pol ist die Depression ...".
Tatsächlich wird die Wirtschaft in ihren extremen Ausformungen, in der Manie des Booms und der Depression der Krise, mit gleichem Vokabular und ähnlichem Befund beschrieben, wie das Individuum. Hinzu kommt, dass die Diskussion über wirtschaftliche Phänomene auch nur da intensiv betrieben wird, wo Manie und Depression offensichtlich werden: bei ungesunden Kapitalakkumulationen in Märkten oder dem wirtschaftlichen Niedergang, der Depression, der Arbeitslosigkeit. Wir sind also im psychischen wie im ökonomischen Fall in unserer Stimmungs-Wahrnehmung "gepolt".
Vergeblich zitieren so viele unserer Weisen die Gründerväter der Philosophie Platon und Aristoteles, welche die ausgeglichene Stimmung der "Mitte" als das eigentliche Ziel menschlicher Existenz bewarben. Mit wenig Erfolg. Wir anerkennen ihre tiefe Weisheit - und machen dann trotzdem weiter, als wäre das ökonomische Leben gleichsam als hochalpines Drama angelegt, als Abfolge von steilem Aufstieg und tiefem Fall.
Das Paradox der Zufriedenheit
Dabei wäre selbst das abendländisch-christliche Ur-Idyll ohne Anstrengung und Angst gebaut, als zufriedene Bedürfnislosigkeit im Paradiesgarten zwischen den mythischen Strömen Pison, Gihon, Euphrat und Tigris, in dem der Mensch die Schöpfung beaufsichtigte, sich von Pflanzen ernährte und hauptsächlich mit sich selbst zufrieden sein sollte. Dass Selbstzufriedenheit heute eine Hauptsünde in unserem wirtschaftlichen Denken darstellt, da die Un-Tat verderbliche Stagnation nach sich zieht, ist bezeichnend. Aber gleichzeitig ist damit auch ein unauflösliches Paradox verbunden. Denn auch in der Ökonomie ist die Selbstzufriedenheit und die Selbstgenügsamkeit der Idealzustand, in dem Zwänge von Wachstum und Gewinn fehlen und alle scheinbar ewig geltenden Gesetze außer Kraft gesetzt sind.
Der Ökonom Joseph Schumpeter hat das in seinen Überlegungen zu einer perfekten Volkswirtschaft auf den Punkt gebracht. In diesem Idealzustand, so Schumpeter, gibt es weder Wert noch Gewinn. Vielmehr sei der Wert "ein Symptom von Armut" und "Gewinn ein Zeichen der Unvollkommenheit". Der Grund: In einer möglichen ökonomischen Vollendung kann es keine Bedürfnisse mehr geben, da sie alle gestillt sind und damit auch keine (ökonomischen) Werte, denn der Wert bemisst sich aus der Intensität des Bedarfs. Dem entsprechend gäbe es auch keinen Gewinn, da kein Produkt mehr wert sein könnte, als die darin enthaltene Arbeitsleistung und Materialsubstanz. Der ideale volkswirtschaftliche Zustand ist demnach nicht unendlicher Reichtum, sondern schlichte Sättigung.
Mit diesem Gedanken im Hinterkopf, nämlich dass das Ziel der Ökonomie die Mittel, die dahin führen, außer Kraft setzt, lässt sich eine Analyse der wirtschaftlichen Extreme, also der Stimmungen Euphorie und Depression besser durchführen. Am besten geht man da wieder in die Paradieserzählung und damit in den Idealzustand zurück.
Denn dort finden wir die menschlichen Grundprobleme dargestellt, an denen sich bis heute nichts geändert hat. Gewöhnlich wird die Schlange, das Böse, für die Ursünde verantwortlich gemacht: "Iss von der verbotenen Frucht und du wirst mächtig sein wie Gott", ist ihr Versprechen. Und der Mensch gehorcht.
In diesem Gehorchen äußert sich seine Unzufriedenheit. Sie ist nichts anderes, als die Abwertung des Istzustandes im Paradies durch die Spekulation über das Bessere in der Zukunft. Die Schlange stiftet Adam und Eva zum Fortschritt an. Das Böse ist so gesehen eine sehr menschliche und gleichzeitig sehr marktwirtschaftliche Figur: Denke das Unerhörte, wage Existenzielles, gewinne Maximales. Heute werden so erfolgreiche Unternehmer beschrieben.
Doch während der Mensch mit der Erfindung von Zins und Geld das Fortschritts-und Wachstumsprinzip immer weiter treibt, scheint ausgerechnet der anstiftende Teufel in vielen literarischen Werken nicht einfach nur Böse und verschlagen zu sein. Nein, der Teufel ist ein Diener der Rationalität und des Hausverstandes.
Teuflische Geschichten
Selbst als Mephistopheles meint er warnend Faust und Kaiser, was es denn heißt, Geld zu drucken und damit Vermögen aus dem Nichts zu schaffen: "Ich schaffe, was ihr wollt, und schaffe mehr. Zwar ist es leicht, doch wiegt das Leichte schwer." Viel direkter hört das heute die Europäische Zentralbank angesichts der von ihr angestrengten Euroflut zur Stabilisierung der Finanzmärkte. Aber reagieren tut sie ebenso wenig wie Faust und der Kaiser.
In Michail Bulgakows "Meister und Margarita" tritt uns der Teufel als schwarzer Magier Volant entgegen, der sich ausgerechnet dann zu ärgern beginnt, wenn seine Opfer so dumm sind, auf seine unmoralischen Angebote einzusteigen - und sich von ihm mit Unsummen von Geld bestechen zu lassen. Da foppt er mit Geldwundern Varietébesucher oder lässt von ihm Bestochene denunzieren und verhaften. Und so landen die Sünder nach der anfänglichen Euphorie des Reichtums entweder im Gefängnis oder im Irrenhaus, wo sie in Autismus und Schizophrenie enden.
Ein gar nicht unähnliches Stimmungsbild bietet die Weltwirtschaft seit Einbruch der Krise 2008. Moralisch werden die Vertreter der Finanzwirtschaft als Delinquenten einer mörderischen Macht angeprangert, während das System verzweifelte Versuche unternimmt, sich selbst zu weiterem Wachstum zu überreden - egal wie es zustande kommt. Das Manöver endet dann auf der einen Seite in der erwähnten Geldschwemme der Zentralbanken, auf der anderen aber in einem rigiden Sparkurs der Regierungen. Die Bürger wiederum sind die Besucher des Spektakels und fordern von der Politik Geld-und Jobwunder, die so nicht stattfinden können, weil das Wachstum zu gering ist und Politiker keine Magier sind.
Hinter dem Bühnenvorhang dieses Spektakels streiten sich ökonomische Schulen um den Einfluss auf das Geschehen auf der Bühne und versprechen die Zukunft, wenn man sich nur an ihre Lehren hielte. Dabei überhäufen sie einander mit Vorurteilen und übler moralischer Nachrede. Nach dem Urteil des "Neoliberalen" ist der "Keynesianer" einer, der das Steuergeld und damit das Vermögen zum Fenster hinauswirft, der Schuld um Schulden auf uns lädt. Auf der anderen Seite der Vorurteils-Schlacht steht der Neoliberale, der nach Ansicht seiner Feinde an seinem Egoismus zugrunde gehen wird, und wir mit ihm. Was dabei herauskommt, ist bescheiden an Erkenntnisgewinn und Lösungsansätzen, selbst wenn es um die Methodik geht.
Selbst der Vorzeigeökonom der Kapitalismuskritik Thomas Piketty bedient sich zur Berechnung des "Kapitals im 21. Jahrhundert" eines neoklassischen Wachstumsmodells, das zur Erfüllung der Zielvorgabe des Autors Parameter wie Einkommensunterschiede, Konsum, Banken- und Zinspolitik einfach ignoriert. Kritische Stimmen dazu, etwa von Heiner Flassbeck scheinen nicht gefragt. Das Resultat solcher Analyse entspricht der vorherrschenden Stimmung über die Ungerechtigkeit der Vermögensverteilung und der Ausbeutung. Am Ende aber bleiben regierende Politiker als untätige Sprecher des angeklagten Systems übrig, das den Bürgern nunmehr als Ausgeburt globalisierter Ungerechtigkeit scheint.
In "Meister und Margarita" kommt es übrigens zu einer in diesem Zusammenhang vielleicht ganz interessanten Form der "Kapital-Flucht". Einem schwatzhaften Moderator das Haupt vom Rumpf getrennt, ehe man ihn mit wieder aufgesetztem Caput entlässt. Eine nicht unähnliche Stimmung ist heute in der hiesigen Politik zu beobachten. Es wird enthauptet, vor Entsetzen geschrien und aufgeregt gejohlt, ein neuer Kopf, gleich welchen Inhalts, wird gefunden, aufgeschraubt und auf eine Reise geschickt, die bloß zum nächsten Richtplatz führen kann.
Auswege und Sackgassen
Gibt es also Auswege aus der ökonomischen Stimmungsgesellschaft, die zwischen den Extremen pendelt? Sicher. Aber dazu bräuchte es langfristiges Denken. Ökonomen und Politiker scheinen in immer kürzeren Abständen immer bescheidenere Erfolge anzustreben - eine Art Schweinezyklus der politischen Ökonomie. Wer hingegen an einem längerfristigen Konjunkturzyklus denkt, langfristig investiert und reformiert, braucht sich vor Krisen nicht zu fürchten. Denn er stellt sich damit außerhalb eines Systems, das Idee und Sinn verloren hat.
Oder um ins Paradies des Glaubens oder zum ersten Überich der christlich abendländischen Gesellschaft, Gott, zurückzukehren: Wenn dieser Gott auf der Anklagebank der menschlichen Vernunft Platz nehmen muss, wegen der Fehlerhaftigkeit seiner Schöpfung. Wo sitzen dann erst jene Geschöpfe, die nicht einmal aus den eigenen Fehlern lernen? Jene also, die staunend zusehen, wie sich ihr eigenes ökonomisches Vehikel in einem wilden Auf und Ab aus Gier und Panik, Blase und Platzen, Manie und Depression, der letzten Klippe nähert.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!