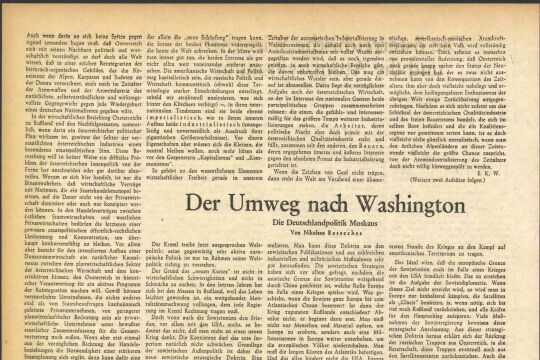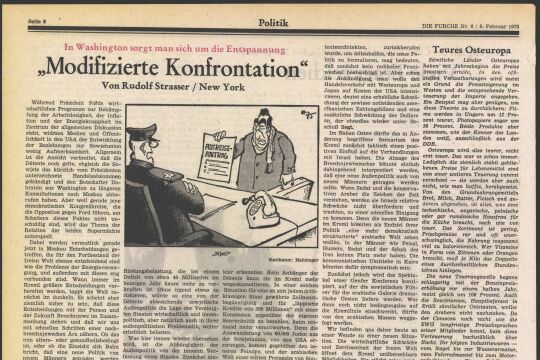Im Zentrum der Macht
Wie man fiktive Probleme löst und ein echtes Problem wie die Jugoslawienkrise verschläft.
Wie man fiktive Probleme löst und ein echtes Problem wie die Jugoslawienkrise verschläft.
Das ungeliebte, bewunderte, nachgeahmte und immer wieder angeprangerte Amerika, wie funktioniert es eigentlich? Was bringt einen Bush dazu, seine Bataillone nach Irak und Somalia zu schicken und den politisch völlig anderen Clinton, damit fortzufahren? Robert L. Hutchings schrieb mit "Als der Kalte Krieg zu Ende war" einen "Bericht aus dem Inneren der Macht". Er versucht, Amerikas Politik verständlich zu machen. Hutchings weiß, wovon er spricht, denn er saß selbst im Innersten des Machtapparats. Nach einer akademischen Karriere, wobei er sich mehr durch Zufall auf Osteuropa spezialisiert hatte, kam er über Radio Free Europe, wo er zum Vizedirektor aufstieg, nach Washington und wurde mit dem Amtsantritt von Präsident Bush Direktor für Europäische Angelegenheiten des Nationalen Sicherheitsrates. Seine Vorschläge wurden des öfteren Grundlage der offiziellen Politik der Vereinigten Staaten.
Obwohl Präsident Bush derselben allgemeinen politischen Richtung angehörte wie sein Vorgänger Reagan, brachte er die Außenpolitik auf einen neuen Kurs. Mit einer völlig neuen Mannschaft machte er sich daran, seine "Grand Strategy" zum Aufbau einer neuen Weltordnung zu verwirklichen. Zur neuen Mannschaft gehörte auch der Mittdreißiger Hutchings. Es ging Bush darum, die nunmehr exklusive Supermacht Amerika in den Dienst einer Demokratisierung der Welt zu stellen. Der Kalte Krieg sollte beendet werden, und zwar ohne Konzessionen an die Sowjetunion, etwa was Deutschland und seine Zugehörigkeit zur NATO betraf. Die demokratische Neue Weltordnung sollte jedoch auch Rußland einbeziehen.
Die "Grand Strategy" war gut, meint der Autor, doch nach den ersten großen Erfolgen entwickelte sich alles so schnell, daß mehr und mehr auf Sicht navigiert werden mußte. Besonders das jugoslawische Problem habe gezeigt, daß Europa noch nicht imstande war, seine Probleme selber zu lösen: "Diese Tatsache öffnete dann allerdings eine gewaltige Kluft zwischen der Führungsrolle, die wir geltend machten, und der Rolle, die wir tatsächlich zu übernehmen bereit waren."
Gorbatschow warf gleich einmal alle internen amerikanischen grandstrategischen Pläne über den Haufen, indem er vor der UNO-Vollversammlung ankündigte, die sowjetischen Streitkräfte unilateral um 500.000 Mann zu reduzieren und erklärte, daß die Anwendung oder Androhung von Waffengewalt kein Instrument der sowjetischen Außenpolitik mehr sein sollte. Die amerikanischen Gremien, die mit der Entwicklung einer kohärenten Außenpolitik beschäftigt waren, entschlossen sich in dieser Situation dazu, nichts zu überhasten. Unmittelbare Reaktionen konnten nur schaden, wie sie meinten, denn zuerst mußte die Reagansche Altlast an verfehlter Außenpolitik abgebaut werden. Auf der anderen Seite sollte Margaret Thatcher auf den Boden der Wirklichkeit zurückgeholt werden, die der Ansicht war, Amerika habe zwar die Macht, doch nicht die Fähigkeit, die westliche Welt zu führen. Die eigentliche Führungsrolle stünde den Briten mit ihrer jahrhundertelangen weltpolitischen Erfahrung zu. Doch in der amerikanischen Sicht war Europa meilenweit davon entfernt, mit sich selber fertig zu werden.
Doch Hutchings und seine Kollegen hatten nicht nur mit der großmachtsüchtigen Margaret Thatcher Schwierigkeiten, sondern auch mit dem ebenfalls imperial denkenden französischen Präsidenten Mitterrand. Die Wiedervereinigung Deutschlands stürzte beide in große Verwirrung. Einerseits fehlte Frankreich eine Ostpolitik, die über den Versuch hinausging, mit der Sowjetunion ein möglichst gutes Verhältnis zu haben. Das hing, laut Hutchings, mit dem "ältesten Dogma der französischen Diplomatie, der Alliance de Revers zusammen, des Bündnisses mit den Nachbarn eines potentiellen Feindes". Aber, fragten sich die amerikanischen Politikentwickler, wenn man schon solche Angst vor einem vierten deutschen Reich hatte, wäre es da nicht vernünftiger gewesen, bessere "Beziehungen zu den Staaten östlich von Deutschland zu kultivieren, allen voran Polen? Wir in Washington hätten eine stärkere Rolle Frankreichs als Gegengewicht zu einem sich womöglich exzessiv entwickelnden wirtschaftlichen und politischen Einfluß der Bundesrepublik" begrüßt. Kurz, auch in Washington hatte man Ängste vor dem zu stark werdenden deutschen Partner.
Über den Einigungsprozeß Europas gab es in der amerikanischen Führung "starke Ambivalenzen". Die Europäer, meint Hutchings, hätten recht gehabt, wenn sie die amerikanische Haltung als feindselig einschätzten, sowie man von der abstrakten Absicht zur konkreten Einrichtung eines Binnenmarktes schritt. Doch die Schnelligkeit der Entwicklung rollte über alle Bedenken hinweg. Kaum hatte sich die amerikanische Administration entschlossen, der Schaffung des gemeinsamen Marktes keine Hindernisse in den Weg zu legen, stand sie schon wieder unter dem Druck, Partei in den innereuropäischen Auseinandersetzungen, betreffend die Natur der neuen Union, zu ergreifen. Die US-Politiker sorgten sich vor allem um den Weiterbestand des atlantischen Modells. Hutchings zufolge "war die Macht der Vereinigten Staaten als Ausgleich des ... Übergewichts der Sowjetunion und als Gegengewicht zu einem erstarkten Deutschland ... gefordert."
Die Franzosen und die Brüsseler Kommission unter Jacques Delors vertraten vor allem das Konzept eines zentralistischen Europa, das sich langsam vom Schutzschirm der USA lösen würde. Sie wollten eine neue Struktur mit Frankreich an den zentralen Kommandostellen fixieren, bevor Deutschland zu stark wurde. Die Briten unter Thatcher waren für ein "Europa der Nationen" und die Deutschen "hatten ein Europa im Sinn, in dem Grenzen ihre Bedeutung verloren haben". Die französische und die deutsche Haltung mochten einander ähneln, "doch die konzeptionellen Unterschiede zwischen dem französischen Supranationalismus und dem deutschen Subnationalismus waren entschieden größer, als beide Seiten zugeben wollten". Die neue Weltordnung erwies sich in dieser Situation ständigen Wandels und von allen Seiten auftauchender widersprüchlicher Visionen bald als Wunschdenken. Kaum hatten sie eine neue Perspektive entwickelt, mußten sich die Denker im Nationalen Sicherheitsrat schon wieder etwas Neues einfallen lassen, weil sich die Lage neuerlich verändert hatte. Den USA ging es vorrangig um die Rettung der NATO. Die Generation, die nun an der Macht war, von Präsident Bush über Außenminister Baker bis Bob Gates, den Leiter der "European Strategy Steering Group", hatte Schwierigkeiten mit den neuen Verhältnissen. Sie wollten den Kalten Krieg beenden, doch "stammten ihre Bezugspunkte nun einmal aus dem ihnen vertrauten Rahmen des Zweiten Weltkriegs ... zu den neuen Verhältnissen, in die wir nun eintreten sollten, paßte dieser Denkrahmen nicht mehr".
Keine Meinungsverschiedenheiten gab es über die "Führungsrolle der USA, die Bedeutung von Machtpolitik, vor allem aber den Einsatz von militärischer Macht zu außenpolitischen Zwecken". Das galt auch für die Anwendung von Macht auf wirtschaftlichem, politischem, moralischem und psychologischem Gebiet. Was dies konkret bedeutet, sehen wir daran, wie die USA ihre Interessen im Bananen-, Hormon- und im Krieg um genmanipulierte Lebensmittel durchsetzen. Diese Art von Machtpolitik habe auch für die Beziehungen der Bush- und der ihr folgenden Clinton-Administration mit dem neuen Rußland gegolten, sich aber bald als Fehler herausgestellt.
Man hätte den Russen keine wirtschaftlichen und politischen Maßnahmen aufdrängen, sondern diskret helfen sollen, ihr Haus selbst in Ordnung zu bringen. Man dürfe aber bei solchen Problemen nicht vergessen, daß es nicht das Interesse der USA sein konnte, einen potentiellen Gegner zu stärken.
Mit Entscheidungen über militärische Einsätze hatte der Autor erst später zu tun, bei den Beratungen über Irak und Somalia war er nicht dabei. Gerade darüber hätte man gern mehr erfahren. Das Ende der Sowjetunion und die Verwirrung der amerikanischen Politiker hat er dagegen aus nächster Nähe miterlebt. Er zeigt einige der Fehler, die begangen wurden; ob er damals bessere Vorschläge eingebracht hat, läßt er offen. Europäer wie Amerikaner schoben in dieser Zeit knifflige Entscheidungen systematisch hinaus, wobei schon abzusehen war, daß mit jeder verfehlten Gelegenheit, etwa den sich entwickelnden Konflikt in Jugoslawien zeitgerecht abzuwürgen, die Probleme nur schwieriger wurden. Vor allem glaubte die amerikanische Führung zuerst gar nicht an die Gefahr der jugoslawischen Auflösung, wobei auch hier die Bezugspunkte aus dem Zweiten Weltkrieg mit der Angst vor dem deutschen Machtzuwachs den Blick verstellten.
Hutchings hat sein Buch nicht als Aufdecker, sondern als Verteidiger der US-Politik geschrieben, vermittelt aber Verständnis für Mechanismen der Macht, die nicht nur in den USA wirksam sind.
Als der Kalte Krieg zu Ende war. Bericht aus dem Innern der Macht. Von Robert L.- Hutchings. Alexander Fest Verlag, Berlin 1999. 490 Seiten, Ln., öS 423,-/E 30,74
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!