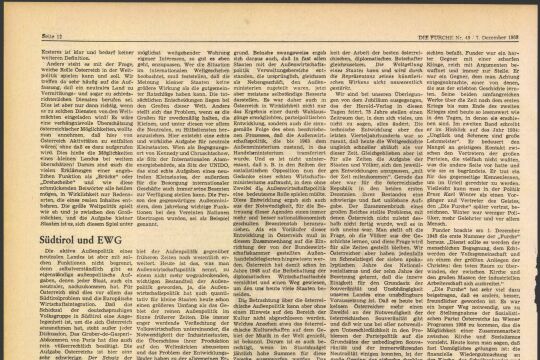Besuchsdiplomatie ist unersetzlich. Dabei fällt kaum ins Gewicht, wessen Hand Türklinken zuerst gedrückt haben.
Immer stärker setzt auch moderne Außenpolitik heute das Mittel der Besuchsdiplomatie, den direkten, persönlichen Kontakt zwischen Entscheidungsträgern ein, um ihre Ziele zu verfolgen, Beziehungen anzuknüpfen, nicht zuletzt auch um das Bild eines Landes im Gestrüpp heutiger weltpolitischer Landschaft klar zu konturieren. Dies gilt besonders für kleinere und mittlere Staaten, die sich in Weltpolitik und Weltwirtschaft nicht allein durch ihr wirtschaftliches oder militärisches Gewicht bemerkbar machen können. Auch Mitgliedschaft in der Union enthebt diese Länder noch lange nicht von der Aufgabe, Identität und Profil im internationalen Leben herauszuarbeiten.
Spezifizität, Setzen geografischer oder sachlicher Schwerpunkte wird dabei erfolgversprechender sein als flächendeckende Universalität, sind doch gerade bei kleinen und mittleren Staaten personelle wie materielle Ressourcen beschränkt: eine Aufgabe, die die alte Eidgenossenschaft mit der Privilegierung humanitären Völkerrechts meisterlich gelöst hat.
Immer stärker verschiebt sich heute Besuchsdiplomatie auf die höchste, meist produktivste politische Ebene, wird zur Gipfeldiplomatie. Treffen der G7 oder der G8, des Europäischen Rates, regionale Gipfel oder die der Blockfreien sind zum diplomatischen Alltag geworden. Aber nicht nur amerikanische und russische Präsidenten, zuletzt Bush und Putin, bedienen sich dieses Mittels. Wiewohl konstitutionell unterschiedlich ausgestattet zählen Staatschefs heute zu wichtigen Akteuren einer keineswegs nur zermoniell zu verstehenden Gipfeldiplomatie: selbst von gekrönten Häuptern geht oft politischer oder wirtschaftlicher Gewinn aus.
Bundespräsidenten haben seit 1955 eine oft äußerst effektive Besuchsdiplomatie betrieben, die mit Namen wie Adolf Schärf, Franz Jonas oder Rudolf Kirchschläger verbunden war. Dass Vorbehalte besonders der westlichen Welt den außenpolitischen Radius eines österreichischen Staatsoberhauptes sechs lange Jahre lang erheblich einschränkten war für die österreichische Außenpolitik - dadurch erstmals seit langem in die Defensive gedrängt - ein empfindlicher Rückschlag. Es ist für die österreichische Außenpolitik daher zweifellos ein Gewinn, verfügt sie heute wieder über ein Staatsoberhaupt, das in allen Hauptstädten der Welt, vor allem der westlichen, willkommen ist.
Freilich kann sich Besuchsdiplomatie, vor allem auch die österreichische, nicht auf Besuche des Staatsoberhauptes allein beschränken, zieht ihm die Bundesverfassung - die reale wie die geschriebene - doch Grenzen. Gerade die heutige Lage Österreichs - nicht zu vergessen die noch immer spürbaren Folgen der großen Vertrauenskrise zwischen Österreich und seinen EU-Partnern sowie anderen westlichen Staaten im letzten Jahr - verlangt daher sorgsame Abstimmung. Dies gilt in geographisch-politischer wie in zeitlicher Hinsicht. Dabei war es sicher kein Fehler, wenn einer der Schwerpunkte jüngster österreichischer Besuchsdiplomatie der Nahe Osten beziehungsweise die arabische Welt waren. Die beträchtlichen Sympathiewerte zu erhalten, die Österreich seit den Tagen Bruno Kreiskys in diesem Teil der Welt genießt ist sicher eine der wichtigsten Aufgaben heutiger österreichischer Außenpolitik. Dabei fällt kaum ins Gewicht, wessen Hand Türklinken zuerst gedrückt haben sollte.
Es sollte aber nicht übersehen werden, dass auch andere Regionen der Weltpolitik aus politischen wie wirtschaftlichen Gründen österreichische Präsenz verlangen. Dazu gehören trotz hartnäckiger Krisen Lateinamerika und der karibische Raum, Ozeanien aber auch Teile Südostasiens und der indische Subkontinent. In vielen dieser Länder und Regionen hat sich seit Jahrzehnten kein österreichisches Regierungsmitglied oder gar Staatschef blicken lassen. Von Vorteil wäre dabei ein arbeitsteiliges Herangehen, bei dem sich Staatsoberhaupt und Regierung (vielleicht unter gelegentlicher Einbeziehung der Opposition) abstimmen. Nicht zuletzt deshalb, weil durch viele der letzten Kabinettsumbildungen die Zahl verfügbarer Regierungsmitglieder geschrumpft ist und die auch in vielen anderen Ländern für Reisediplomatie nützliche Figur des Staatssekretärs aus der österreichischen politischen Landschaft fast verschwunden ist. Andere Länder, selbst die Schweiz, haben die Spärlichkeit "echter" Minister dadurch kompensiert, dass sie hohe Beamte mit klingenden Titeln bis zum Staatssekretär oder Vizeminister ausgestattet und damit politische Türen in anderen Hauptstädten wieder geöffnet haben. Dies könnte auch für Österreich interessant sein.
Kritik an manchen Aspekten jüngster österreichischer Reisediplomatie sollte also nicht einem unverzichtbaren Instrument auch moderner Diplomatie gelten. Hohn und Spott, der sich nicht erst seit heute über die Reisefreudigkeit österreichischer Politiker ergießt, kommt meist aus einer "Staberl" Mentalität, das heißt provinzieller Abschätzigkeit gegen jedes Auftreten im Ausland und trifft daher nur selten den wirklichen Kern der Sache.
Die Notwendigkeit von Besuchsdiplomatie auch in der heutigen Zeit steht außer Frage. Fragwürdig wird sie nur bei dem oft recht durchsichtigen Versuch, den Wettlauf nach Punkten in der Innenpolitik mit vorgeblicher Besuchsdiplomatie zu gewinnen und dabei ihren eigentlichen Zweck - Verständnis und Zustimmung in der Welt zu gewinnen - zu übersehen.
Der Autor ist Botschafter und Außenminister a.D.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!