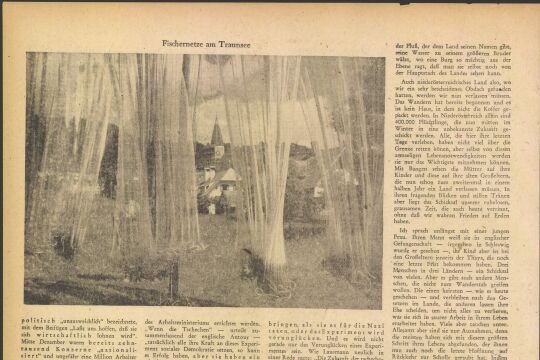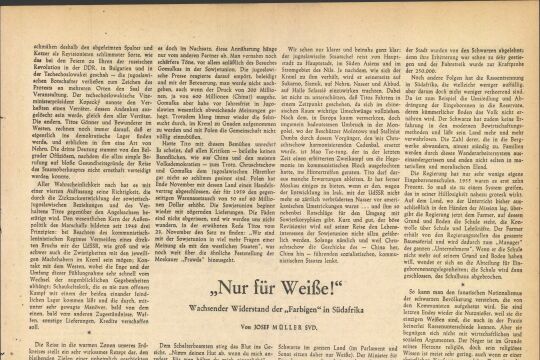Mit Kokosmilch und Zuckerwasser wurde auf den Nordmolukken der Friede besiegelt. Doch das Misstrauen zwischen Christen und Muslimen dauert an.
Die ausgebrannte Moschee von Gorua: Hier wurden 50 Menschen umgebracht. Ein kleiner weißer Gedenkstein vor der Moschee markiert das Massengrab und erinnert an den 31. Dezember 1999. An der hinteren Wand in der Moschee sieht man einen neuen Farbanstrich. "Hier haben sie die Blutspuren übertüncht", erklärt Jerda Djawa, eine junge Pastorin der Evangelischen Kirche von Halmahera. Vor der Moschee sitzen drei Männer mit ernsten Gesichtern. Sie sind Moslems aus Gorua. Sie gehören zu den ersten Flüchtlingen, die zurückgekehrt sind an den Ort des Massakers. Auf die Frage, ob sie Bitterkeit im Herzen spüren, antwortet einer der drei Männer knapp: "Es geht schon besser."
Von Herbst 1999 bis in die Mitte des Jahres 2000 haben sich Christen und Moslems auf den Inseln der Nordmolukken brutal bekämpft. Es fing mit einem Gebietskonflikt auf Halmahera, der Hauptinsel der Nordmolukken, an. Einwanderer, von der Vulkaninsel Makian forderten einen eigenen Distrikt um den Ort Malifut. Dagegen wehrte sich die einheimische Bevölkerung aus dem Kao-Distrikt - nicht zuletzt, weil eine Goldmiene dem neuen Distrikt zugefallen wäre. Es kam zu Überfällen und schließlich zur Zerstörung Malifuts durch die Kao-Leute. Von Anfang an gab es gezielte Versuche, den Konflikt entlang der Religionsgrenzen zu schüren.
Jeder misstraute jedem
Die moslemischen Flüchtlinge aus Malifut, die in die Provinzhauptstadt Ternate geflohen waren, entluden im November 1999 ihren Hass in Pogromen gegen Christen. Jerda Djawa erinnert sich, als sie Ende 1999 vom Studium wieder auf ihre Heimatinsel kam, wurde sie im Hafen gewarnt - weil sie Pastorin sei. Jede Gruppe hätte der anderen misstraut, so Djawa. So wäre es leicht gewesen, einen Anlass zum Kampf zu finden.
Im Galela-Distrikt sind ganze Landstriche verwüstet. Die Häuser wurden angezündet. Dachstühle und Fenster brannten aus, nur die Fundamente und Mauern stehen noch. Nun hat Regenwald auf Halmahera viele Ruinen schon wieder zurückerobert: Die Mauerreste versinken unter Büschen und Ranken. Mit Macheten, Speeren und selbstgebastelten Schrotflinten sind die Menschen aufeinander losgegangen, erklärt Ruddy Tindage, der beim Ausbruch der Kämpfe als Pastor in Galela arbeitete.
In Duma steht die Ruine einer großen Kirche. Der Turm wurde gesprengt. Im christlichen Tobelo, dem Nachbardistrikt zu Galela, ist man überzeugt, dass die indonesische Armee die Moslems mit schweren Waffen ausgerüstet hat. Außerdem kamen im Laufe des Frühjahrs 2000 Kämpfer des Lasker Jihad (Heiliger Krieg) in den Norden Halmaheras und haben die Kämpfe dort zu Gunsten der Moslems entschieden. Einer der führenden Leute aus Tobelo meint: "Wir kennen die Wurzel der Kämpfe: Wenn die Armee gewollt hätte, hätte sie hier innerhalb von 24 Stunden für Ruhe sorgen können." Eine Einschätzung, die plausibel klingt, wenn man weiß, dass der ganze Verkehr über eine Küstenstraße laufen muss. Und derselbe Mann fügt hinzu: "Aber wir wollen die Armee nicht öffentlich angreifen, denn sie soll weiter ihren Job machen." Auch die "International Crisis Group" hat Material gesammelt, das belegt, dass Armee-Einheiten sich auf die Seite einer der kämpfenden Parteien geschlagen, bzw. dieselben mit Waffen versorgt haben, statt die Kämpfe zu verhindern.
Laute Kritik an der Armee
Der Indonesienexperte vom Evangelischen Missionswerk in Südwestdeutschland, David Tulaar, meint, es gebe bisher keine gesicherten Beweise dafür, dass Unruhen bewusst von der Militärführung geschürt würden, um die eigene Unabkömmlichkeit zu beweisen. Aber man müsse sich schon fragen, warum das indonesische Militär, das Suharto zur stärksten Armee Südostasiens machte, sich in den jüngsten Konflikten so schwach und zurückhaltend zeige.
Der Krieg hat ein Drittel der Bevölkerung zu Flüchtlingen gemacht. Sie leben in selbstgebauten Hütten aus Holz und Palmwedeln, alten Markthallen oder bei Verwandten. Fast alle wollen zurück, aber die meisten sind misstrauisch, ob die Lage in ihrem Heimatort sicher ist. Außerdem fehlen Ihnen Mittel, um ihre Häuser wieder aufzubauen. Die Regierung will alle Flüchtlinge bis Jahresfrist zurücksiedeln. Das sei völlig unrealistisch, sagt Mona Saroinsong vom kirchlichen Krisenzentrum in Manado auf der Nachbarinsel Sulawesi. Die Regierung setzt die Flüchtlinge unter Druck, indem sie seit Anfang des Jahres die Hilfen an die Flüchtlingslager aufgekündigt hat. Und die Zusagen der Regierung, dass die Rückkehrer Material zum Hausbau erhalten, finden, so Saroinsong, keinen Glauben bei den Flüchtlingen. Manche fürchteten auch die Rache ihrer alten Nachbarn - trotz der feierlich zelebrierten Versöhnung.
Pastor Ruddy Tindage zeigt ein Videoband von der Versöhnungszeremonie in Tobelo. Unter den Augen von Regierungsvertretern und Militärs trafen sich im April letzten Jahres christliche und moslemische Milizionäre. Sie legten ihre Waffen in die Mitte: zwei Speere, zwei Schwerter und zwei Schilde. Darüber wird Kokosmilch gegossen als Zeichen der Reinheit und Zuckerwasser als ein Zeichen für ein süßes nicht mehr bitteres Herz. Dann übergeben die verfeindeten Milizionäre sich auf Schwertern Tabak. "Ihr Feinde sollt nun in Frieden leben", proklamiert eine Stimme durch das Mikrofon. Milizen und Vertreter beider Religionen unterzeichnen eine Friedenserklärung.
Zögerliche Rückkehr
Die Witwen aus Duma aber sind sich nicht sicher, was sie von dem Wort Versöhnung halten sollen. Sie hätten gesehen, wie ihre Männer in der Kirche umgebracht wurden, berichtet eine der Frauen, die nun in einem Flüchtlingslager in Tobelo leben. Außerdem sei eines ihrer Enkelkinder entführt worden. Die Entführer würden fünf Millionen Rupiah Lösegeld von ihr verlangen. Ja, zurück nach Duma wolle sie schon. Aber nicht so bald, sagt sie.
In Ternate leitet der ehemalige Rektor der Christlichen Universität von Jakarta, Judo Poerwowidagdo, einen Mediationskurs. In den Kursen kommen Moslems und Christen zusammen. Es gehe darum, dass die Menschen sich ihre eigenen traumatischen Erfahrungen bewusst machen, so Poerwowidagdo. Dann könnten sie auch anderen helfen und später in Konflikten moderieren. Viele Anregungen hat der engagierte Hochschullehrer von einer Reise nach Südafrika bekommen. Aber ob eine Wahrheits- und Versöhnungskommission für die Molukken das Richtige ist, will er nicht sagen. "Die Leute müssen selber ihre Lösung finden", ist er überzeugt. Aber dann fügt er doch hinzu: "Eine Lehre aus Südafrika ist: Ihr müsst vergeben, sonst habt ihr keine Zukunft. Das schlagen wir den Leuten vor."
Wahrheitskommission?
Jerda Djawa erzählt, wie nach dem Krieg Männer zu ihr gekommen seien und erzählten, dass sie Menschen umgebracht hätten. Sie hat ihnen geraten, offen vor Gott zu bekennen, was sie getan haben. "Ich weiß nicht, was Gott mit Ihnen tun wird. Ich kann Gott keine Vorschläge machen." Aber ein öffentliches Bekennen vor einer Wahrheitskommission scheint ihr schwierig. Das könnte neue Gräben aufreißen. Sie kann sich nicht vorstellen, dass jemand zu solch einem Gesichtsverlust bereit sein wird.
Eine theologische Neubesinnung ist ihr wichtig: "Die Erlösung Christi ist ja nicht nur für uns, sie ist für alle Menschen", sagt die junge Theologin. In vielen Köpfen herrsche noch die Vorstellung, dass nur die Christen die Guten und Geretteten seien. Den Kindern sage man, sie sollen nicht mit den Ungläubigen Freundschaft schließen. Durch solche Vorstellungen sei das Misstrauen in den Menschen gewachsen, ist Djawa überzeugt.
Vertrauen wird nur langsam wieder wachsen. Ende Juli wurden bei Razzien in Gorua und Umgebung Waffen entdeckt. Und bei mehreren Explosionen in der indonesischen Stadt Ambon, dem Verwaltungszentrum der Molukken, wurden Dutzende Menschen verletzt. Die Lage ist fragil - und es bleibt die Frage, ob Versöhnungszeremonien die Suche nach Gerechtigkeit ersetzen können.
Der Autor arbeitet als Journalist für das Evangelische Missionswerk in Südwestdeutschland.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!