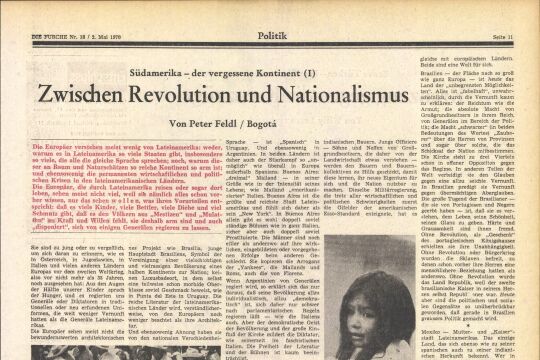Die Vergabe der Olympischen Sommerspiele 2016 an Brasilien war eine Sternstunde für Lateinamerika. Der frühere Hinterhof der USA und vergessene Kontinent hat sich emanzipiert. Charismatische Führungsgestalten begeistern die Massen und der Ressourcenreichtum trägt seinen Teil zum Aufstieg bei – an dem aber sehr viele nach wie vor nicht teilhaben.
Die Aufnahme in den Olympischen Adel ist der Höhepunkt im brasilianischen Höhenflug. Die erstmalige Vergabe des wichtigsten Sportereignisses der Welt nach Südamerika strahlt über die Grenzen des Landes auf den Kontinent und schiebt das vergessene, vernachlässigte und unterschätzte Amerika ins Rampenlicht der Welt. „Als Gott die Welt erschuf, bereitete er Rio für die Olympischen Spiele vor“, sagte Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva nach der Vergabe der Olympischen Sommerspiele 2016 an Rio de Janeiro. Und: „Heute ist ein heiliger Tag für mich. Das ist nicht nur ein Sieg für Brasilien, sondern ein Sieg für ganz Lateinamerika.“
Die Entscheidung zeigt, dass Brasilien nicht mehr länger ein Land „zweiter Klasse“ ist, sondern definitiv zu den „Erste-Klasse-Nationen“ gehört, meint Lula. Das Schwellenland tritt in den Klub der Mächtigen ein. Bis 2016 soll das fünftgrößte Land auch die fünftgrößte Volkswirtschaft stellen. Kein Wunder, dass Lula und sein Land nicht nur im Sport – 2014 wird Brasilien auch die Fußballweltmeisterschaft ausrichten – von der Randlage ins Zentrum rücken. Die Diskussionen um die Aufstockung des Reichenklubs G-8 auf G-20, zu dem in jedem Fall Brasilien gehört, sind ein weiterer Beweis dafür.
„Brasilien ist angekommen – aber wo?“
„Braslien ist angekommen“, schrieb die New York Times unlängst in einem Leitartikel, fragte im Nachsatz: „Aber wo?“ Und antwortete: „Die Börse boomt, so wie Armut und Gewalt die Slums von Rio plagen.“ Im krassen Gegensatz zu der nach außen getragenen Weltoffenheit wird nach innen im wahrsten Sinne des Wortes gemauert: Rund um 13 Slums im touristischen Süden Rios errichtet man gerade eine drei Meter hohe Absperrung. Im kommenden Jahr sind weitere Mauern im Norden geplant. Offiziell wird die Abschottung damit begründet, den angrenzenden Regenwald vor illegaler Abholzung und einem weiteren Vordringen der Favelas zu schützen. Kritiker werfen den Stadtoberen hingegen vor, damit die Armut verstecken zu wollen, die Slum-Bewohner noch mehr als bisher auszugrenzen, zu diskriminieren und in Ghettos zu sperren.
Das brutale Nebeneinander von Reich und Arm, Erfolg und Tragödie in Brasiliens Spaßmetropole gilt über die Grenzen der Stadt hinaus für Brasilien und für Lateinamerika. „Demokratisierung und Wirtschaftswachstum haben in Lateinamerika zu Erfolgen geführt, die soziale Schieflage jedoch nicht beheben können“, analysieren Peter Fischer-Bollin und Kathrin Zeller vom Büro der Konrad-Adenauer-Stiftung in Rio de Janeiro. Sie verweisen auf den „Gini-Koeffizienten“, mit dem die soziale Ungleichheit gemessen wird: Dieser bewegte sich für Lateinamerika „von 1990 bis 2005 zwischen 53,6 und 53,4 Prozent, wobei 0 den Zustand idealer Gleichheit und 100 den völliger Ungleichheit beschreibt.“ Unter „Gleichheit“ versteht man dabei die Gleichverteilung des Einkommens der Bevölkerung.
Weltweit tendiert der Gini-Index in Richtung mehr Ungleichheit, insofern könnte man den stabilen Wert in Lateinamerika als kleinen Erfolg ansehen. Andererseits sind trotz der Abkehr vom neoliberalen Weg hin zu einer linken Politik im Großteil Lateinamerikas die großen Probleme kaum kleiner geworden: Landlosigkeit, Marginalisierung der indigenen Bevölkerungen, Raubbau, Kriminalität, Drogenhandel … Die positive Ausnahme in dieser negativen Liste ist die Etablierung einer Art Grundeinkommens in einigen Ländern (in Brasilien Bolsa Família, in Chile Solidario oder Oportunidades in Mexiko), die erheblich zur Armuts- bzw. Hungerbekämpfung beitragen konnten.
Chávez im Abstieg und Morales gefangen
„Nach der Dominanz des Neoliberalismus in den neunziger Jahren ist nunmehr ein starker Einfluss des Neopopulismus zu verzeichnen, der in Lateinamerika traditionell eine starke Rolle spielt“, heißt es aus der Konrad-Adenauer-Stiftung vor Ort. Ihre Prognose für die Zukunft lautet: „Die anfängliche Begeisterung einer enttäuschten Wählerschaft für eine staatliche Alternative verliert aber auch in diesen Ländern langsam an Kraft.“ Gemeint sind dabei vor allem Venezuela und Bolivien. Hugo Chávez’ „Sozialismus des 21. Jahrhunderts“ erinnert zusehends an den Realkommunismus des vorigen Jahrhunderts. In Bolivien scheint sich die Pattsituation zwischen dem indigenen Präsidenten Evo Morales und der weißen Oberschicht zu verfestigen, so wie die ungerechte Einkommensverteilung, während sich die Armutsindikatoren verschlechtern. Auch die kommenden Wahlen am 6. Dezember versprechen da keinen Ausweg.
Nach dem Schein und Sein linker Regierungen in Lateinamerika befragt, antwortet der ecuadorianische Politiker und Wirtschaftswissenschafter Alberto Costa im FURCHE-Interview: „Da muss man fragen, was haben sie sich von ihren linken Präsidenten erwartet und was konnten ihnen diese bieten? Die Präsidenten glauben oft, sie brauchen nur an die Macht zu kommen. Aber sie verkennen die Arbeit, die dann zu tun ist. Mit den Indigenen, den Arbeitern, Frauen, Bauern, Studenten, Kleinunternehmer … Es fehlt noch die Gemeinschaft, das Wechselspiel zwischen Regierung und sozialen Bewegungen. Hier gibt es Konflikte.“
Utopien in die Praxis umsetzen
Eine andere Konfliktlinie, die sich über den ganzen Kontinent zieht, ist der schwere Abgang von der Macht: Chávez, Uribe, Ortega, Correa … streben ein Amt auf Lebenszeit an. „Das sind Demokratien im Entstehen“, sagt dazu Alberto Costa, „da fehlen noch solide politische Parteien, um die Macht abgeben und teilen zu können.“
Brasilien präsentiert sich auch in dieser Hinsicht als Vorzugsschüler: Präsident Lula tritt bei der Präsidentschaftswahl 2010 nicht wieder an. Dafür seine alte Weggefährtin Marina Silva. Die sich aber mit Lulas und seiner Arbeiterpartei überworfen hat. Zu wenig sozial, zu wenig grün, wirft sie dem Präsidenten vor. So wie Lula stammt Silva aus bitterarmen Verhältnissen, war Analphabetin bis zum 16. Lebensjahr, arbeitete als Putzfrau und schaffte den Sprung auf die Universität. Der „Mythos Lula“ zieht also weiter. Marina Silva selbst ist voller Tatendrang: „Bis 30 werden wir von unseren Utopien beeinflusst“, sagte die 51-Jährige. „Ab 50 müssen wir sie in die Praxis umsetzen.“
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!