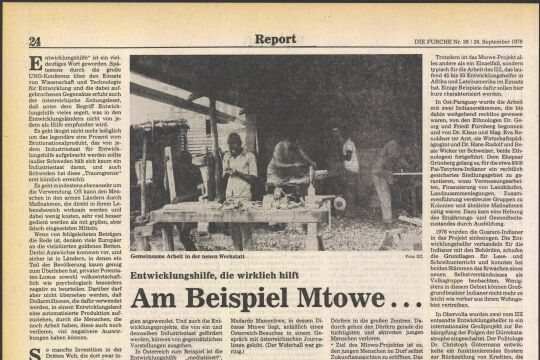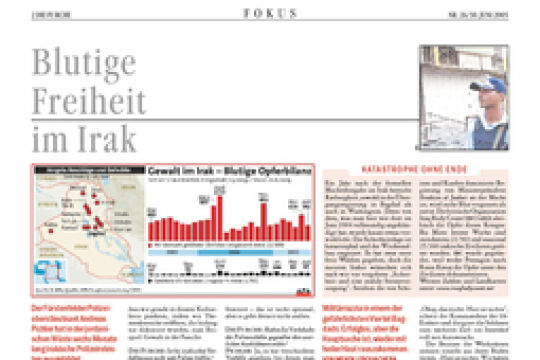Im Nahem Osten, im Sudan, in der Ukraine oder in Afghanistan: In den Krisenherden der Welt arbeiten humanitäre Helfer und Militärs oft nebeneinander. Dürfen sie auch miteinander arbeiten? Über Schutz und Bedrohung an der Schnittstelle zwischen Entwicklungspolitik und militärischer Strategie diskutiert die FURCHE mit Mario Thaler, Geschäftsführer von Ärzte ohne Grenzen, und Walter Feichtinger, Leiter des Instituts für Friedenssicherung und Konfliktmanagement an der Landesverteidigungsakademie des Österreichischen Bundesheeres.
DIE FURCHE: Vor wenigen Wochen wurde ein Krankenhaus von Ärzte ohne Grenzen im Süden des Sudan bombardiert. Es war der zweite gezielte Angriff innerhalb von sieben Monaten. Könnten Ihre Kollegen dort unter militärischem Schutz besser arbeiten, Herr Thaler?
Mario Thaler: Wir lehnen militärischen Schutz ab, haben keine militärischen Begleitfahrzeuge und versuchen auch, von UNbewachten Zivilschutzeinrichtungen Abstand zu halten. Ärzte ohne Grenzen ist eine sehr prinzipienorientierte Organisation. Grundsätze wie Neutralität, Unparteilichkeit und Unabhängigkeit sind im Umfeld von Militär schwer einzuhalten. In einem bewaffneten Umfeld wird die Situation auch für uns unsicherer, wenn wir Zielscheibe von Angriffen werden.
DIE FURCHE: Ist Militärpräsenz eine Bedrohung für humanitäre Helfer?
Walter Feichtinger: Wir bedrohen sicher keine Hilfsorganisationen. Eine indirekte Bedrohung kann in konkreten Fällen aber entstehen. Aber natürlich gibt es auch einen Schutzaspekt. Wenn etwa ein Krankenhaus bewacht wird, drängt sich das Militär ja nicht auf, das passiert in Absprache mit der Organisation. Für viel wichtiger halte ich aber den indirekten Schutz, der kriminelle und kriegerische Elemente aus bestimmten Regionen fern hält, eben weil dort Militär präsent ist. Im internationalen Krisenmanagement muss man das differenziert betrachten. Es kann Situationen geben, wo es für Mitarbeiter von Organisationen überlebenswichtig ist, keine Berührungspunkte mit dem Militär zu haben. In anderen Situationen kann ihnen aber die Militärpräsenz das Leben retten.
Thaler: Gefährlich wird es, wenn das Militär Aufgaben der klassischen humanitären Hilfe übernimmt, und es auch als solche tituliert. Dann ist es für Außenstehende, für die Bevölkerung genau wie für bewaffnete Gruppen, schwer, einen Unterschied auszumachen. Wenn die Grenzen verschwimmen, wird's problematisch. Das ist zum Beispiel in Afghanistan passiert, wo -salopp gesagt - der gleiche Hubschrauber am Vormittag Hilfsgüter transportiert und am Nachmittag Bomben abgeworfen hat.
Feichtinger: Es muss allen klar sein: Ein Militär geht in der Regel mit einem internationalen Mandat in eine Region und verfolgt eine politische Zielsetzung. Hilfsorganisationen haben rein humanitäre Ziele. Das ist ein gravierender Unterschied.
DIE FURCHE: Immer öfter übernehmen aber auch Militärs humanitäre Aufgaben. Darf man humanitäre Hilfe in militärisch-strategische Überlegungen einbauen?
Feichtinger: Ich würde das aus der Warte der Betroffenen sehen: Wenn Menschen Not leiden, kann man keine scharfe Trennlinie ziehen, wer was darf. Oft geht es im ersten Moment darum, wer überhaupt vor Ort ist. Im Kosovo gab es 1999 diese Situation: Am Anfang war niemand vor Ort außer dem Militär. In dieser Phase muss das Militär auch Hilfsgüter verteilen. Sobald andere diese Aufgabe übernehmen, kann es sich auf seine Kernaufgabe beschränken.
Thaler: Besonders bei Naturkatastrophen kann es nötig sein, auf militärische Hilfe zurückzugreifen, etwa beim Transport mit Hubschraubern, wie etwa nach dem großen Erdbeben 2005 in Pakistan. In anderen Situationen ist es schwierig. Unser Anspruch muss sein, dort vor Ort zu sein, wo die Hilfe am dringendsten benötigt wird, und nicht dort, wo das Militär für Stabilität sorgt. Organisationen, die in Afghanistan unter Militärschutz in den Regionen tätig sind, in denen Internationale Truppen stationiert sind, können unmöglich gleichzeitig in anderen Gebieten arbeiten, die das afghanische Militär nicht unter Kontrolle hat. Obwohl die Menschen dort gesundheitlich am wenigsten versorgt sind.
DIE FURCHE: Auch in Afghanistan wurden Ärzte ohne Grenzen-Mitarbeiter ermordet.
Sie haben sich deshalb 2004 aus dem Land zurückgezogen und kamen erst fünf Jahre später zurück. Was war danach anders?
Thaler: Drei Jahre lang haben wir mit allen Gruppierungen -der Regierung, dem amerikanischen Militär, auch den Taliban -unseren humanitären Wirkungsraum ausgehandelt. Das war nur möglich, weil wir mit allen Gruppen geredet haben. Wir haben dann in der instabilen Helmand-Provinz ein Krankenhaus übernommen, das davor vom afghanischen Militär betrieben wurde. Innerhalb weniger Monate potenzierten sich die Behandlungszahlen. Weil wir als neutraler Akteur wahrgenommen wurden, und die Menschen keine Angst mehr haben mussten, für die Taliban suspekt zu werden, weil sie sich behandeln lassen.
Feichtinger: Wer rein der humanitären Hilfe verpflichtet ist, regelt seine Sicherheit dadurch, dass er mit allen Konfliktpartnern ein Arrangement trifft. Das ist für uns anders. Ein Militär wird in der ersten Phase wohl nicht mit den Taliban verhandeln müssen. Es gibt aber auch sehr gute Bespiele für die zivil-militärische Zusammenarbeit in Krisengebieten: Der österreichische Tschad-Einsatz etwa gilt als mustergültig, weil man gut zusammenarbeitete, ohne in die Grenzen des anderen hineinzudringen. Aber es gilt immer: Wenn Militär in einen Konfliktraum hinein geht, gibt es eine Vorgeschichte und eine politische Zielsetzung. Dieser Unterschied macht die Abstimmung manchmal schwierig, weil es im Verhalten vor Ort Unterschiede bringt.
Die Furche: Nicht nur das Verhalten vor Ort wird dadurch beeinflusst, sondern fallweise schon die Finanzierung: Müssen humanitäre Organisationen mit dem Verteidigungsministerium um das Entwicklungsbudget buhlen?
Feichtinger: Im Zuge des Tschad-Einsatzes wurde das diskutiert, aber in meinen Augen waren die Trickspieler unterwegs. Es ging dabei um so kleine Beträge, die dem Militär nichts brachten, und das österreichische EZA-Budget etwas schönen sollten.
Thaler: Die Mittel, die für humanitäre Hilfe zur Verfügung stehen, sind so gering, dass sie im internationalen Vergleich kaum der Rede wert sind. Im internationale Kontext kann man aber beobachten, dass Organisationen, die ihre Aktivitäten mit nationalen Regierungen koordinieren, eher Geld aus staatlichen Katastrophentöpfen bekommen.
Ärzte ohne Grenzen betrifft das nicht, wir sind zu 90 Prozent von privaten Spenden finanziert und verwenden in kriegerischen Kontexten überhaupt kein Regierungsgeld. Das garantiert Unabhängigkeit. Wer sich in Konflikten aber eindeutig auf eine Seite stellt, macht sich zum verlängerten Arm des Militärs
Feichtinger: das ja wiederum ein verlängerter Arm der Politik ist.
Thaler: Gespräche mit Militärs verlaufen meist offen und ehrlich, weil es eine klare Rollenverteilung gibt. Problematisch wird es, wenn man versucht sich hinter anderen Erklärungen zu verstecken. Das passiert meistens von Seiten der Politik. Die Furche: Inwiefern?
Thaler: Wenn der frühere NATO Generalsekretär Rasmussen NGOs als "soft power" einer militärischen Strategie bezeichnet. Oder wenn unser Außenminister Sebastian Kurz behauptet, dass sich Österreich "mit humanitärer Hilfe" an der internationalen Allianz gegen den Islamischen Staat beteiligt. Das ist grundlegend falsch.
Feichtinger: Innerhalb der Anti-IS-Koalition gibt es drei Formen, den direkten Kampf, den indirekten, wenn man etwa Kurden mit Waffen unterstützt, und den dritten, den Sie ankreiden. Der Begriff humanitäre Hilfe ist hier sehr weit gefasst -von Hilfe vor Ort über Flüchtlingslager bis zur Aufnahme von Vertriebenen. Politisch entsteht damit der Eindruck, dass wir uns da in etwas Großes einbringen. Für Sie ist das natürlich problematisch.
Thaler: Besonders für unsere Teams in der Region. Jegliche Vereinnahmung kann sich unmittelbar auf unsere Mitarbeiter auswirken, die dann noch mehr als bisher zur Zielscheibe werden.
Die Furche: Die österreichische Regierung arbeitet gerade an einem "gesamtstaatlichen Auslandseinsatzkonzept", das sowohl das Bundesheer als auch internationale humanitäre Hilfe und Katastrophenhilfe umfassen soll. Wo führt das hin?
Feichtinger: Das ist eine weitere Präzisierung dessen, was wir in den letzten zwanzig Jahren erlebt haben. Im ehemaligen Jugoslawien und in Afghanistan hatten wir zwei große Experimentierfelder, wo notgedrungen erprobt wurde, wie man Regionen und Staaten stabilisiert, die in Kriegen versinken. Durch die Erfahrung hat sich das internationale Krisenmanagement stark weiter entwickelt, und damit auch die zivil-militärische Zusammenarbeit. Ich war in einer Arbeitsgruppe zum österreichischen Auslandseinsatzkonzept, in der sich Vertreter der Ministerien, dem Bundesheer und NGOs getroffen haben. Die Stimmung war spannend, am Anfang voller Neugierde und auch Misstrauen. Innerhalb von zwei Jahren haben wir eine wirklich gute Gesprächsbasis entwickelt, das Vertrauen und das gegenseitige Grundverständnis sind gewachsen. Das halte ich für den wichtigsten Aspekt von zivil-militärischer Kooperation.
Thaler: Die Herausforderung an der zivilmilitärischen Zusammenarbeit ist, dass wir klar festlegen, was die Rolle des Militärs, die Rolle von klassischen humanitären Organisationen und die Rolle von Entwicklungszusammenarbeits-Organisationen ist. Wenn das allen Beteiligten klar ist, und die Grenzen nicht verwischen, ist schon viel gewonnen. In der Praxis wird man immer wieder Kompromisse eingehen müssen, aber es dürfen keine faulen Kompromisse sein.
Feichtinger: Eine Generalregel gibt es nicht, außer vielleicht: Jeder Akteur muss seinen Prinzipien treu bleiben aber anhand der konkreten Situation beurteilen, was vernünftig und für die Betroffenen das Beste ist.