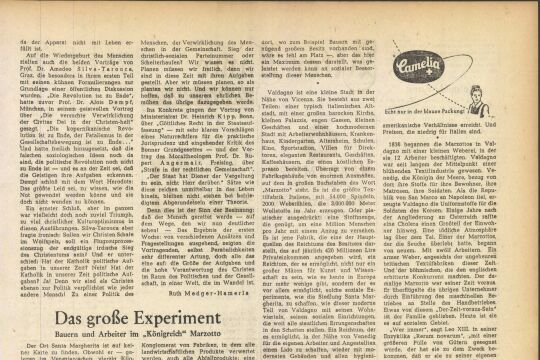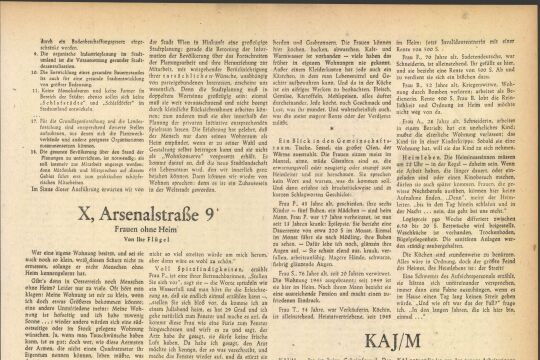Nach zehn Jahren Unabhängigkeit nährt die "Mutter Ukraine" ihre Kinder schlecht. Schattenwirtschaft und ein marodes Sozialsystem machen den Alltag für viele zum Überlebenskampf.
Gelbe und blaue Fähnchen säumen den neuesten Gedenkplatz in Kharkiv, der zweitgrößten Stadt der Ukraine. Zur Feier der zehnjährigen Unabhängigkeit am 24. August dieses Jahres wurde das vorläufig jüngste politische Denkmal errichtet. Dieses Datum kollektiven Nationalstolzes weiß jeder Ukrainer auswendig, landesweit wurden die Städte mit Platzgestaltungen zum Anlass übersät.
Grund zum Feiern gibt es wenig: das Sozialsystem, das in Zeiten des Kommunismus selbstverständlich war, ist zusammengebrochen. In den Krankenhäusern gibt es weder Bettwäsche, noch Essen. Findet der Patient keinen Familienangehörigen, der ihn bekocht und mit Leintüchern versorgt, muss er hoffen, dass vom Nachbarn etwas für ihn abfällt. "Die Älteren erinnern sich noch an eine freie Erziehung, an Spitalsbehandlung, billigeres Essen. Früher war es leichter, zu leben", sagt Vjktor Georgijewitsch. Er ist Professor der Elektrotechnik an der Universität, konstruiert die Elektronik in Flugzeugen und hält Vorlesungen. Doch für Forschung und Entwicklung fehlen die Ressourcen. "Früher hatten wir eine florierende Industrie. Wir lieferten Tanker und Elektronik an die Sowjetunion. Nun ist der Export abgeschnitten, alle Pläne sind gestoppt."
Verlorene Kinder
Vjktor hat inzwischen einen Zweitberuf: 1991 lernte er einen katholischen Priester kennen und erfuhr von der Caritas. Er half mit, in der riesigen Satellitenstadt Saltovka ein Heim für Straßenkinder aufzubauen. Etwa 800.000 Menschen leben in Saltkova in trostlosen, desolaten Betonbauten, durch deren bröckeligen Putz die Eisenarmierung der Zwischendecken rostet. Seit drei Jahren gibt es hier in einem staatlichen Kindergarten die Caritas-Oase der Gewaltlosigkeit, geregelten Mahlzeiten, sauberen Wäsche und liebevollen Betreuung, in der momentan 40 Kinder leben und lernen. "Die meisten kommen aus zerrütteten Familien. Sie haben juridisch keine Eltern mehr", erklärt Vjktor. Die Ukraine ist ein Land der verlorenen Kinder. Viele Eltern können ihre Sprösslinge nicht mehr ernähren, sie verschwinden aus Scham von heute auf morgen. Die meisten Kinder laufen weg und landen auf der Straße. Sie schlafen in Kanalrohren, auf Bahnhöfen, öffentlichen Plätzen, bringen sich mit Betteln, Gelegenheitsarbeit oder Prostitution durch. Offizielle Zahlen sprechen von 90.000 Straßenkindern. Felicitas Filip, die Projektverantwortliche der Caritas für die Auslands-und Katastrophenhilfe in der Ukraine schätzt die Dunkelziffer doppelt so hoch ein.
Die offiziell freie Schulbildung für alle ist ein Mythos. Für Mittelschulen müssen Eltern zahlen oder arbeiten: sie streichen die Wände in den desolaten Gebäuden oder machen sich anders nützlich. Das kommunale Budget reicht kaum für die niedrigen Lehrergehälter, die sporadisch ausgezahlt werden. Für Investitionen bleibt nichts. Geschäfte sind unter diesen Umständen für viele zu teuer, der größte Bazar der Ostukraine befindet sich in Kharkiv. Zwei Mal pro Woche wird hier in der Nacht verkauft, was Händler bei Einkaufsfahrten in die Türkei ergattert haben. Jeder, der einen Stand betreibt, muss Schutzgeld zahlen. Kunden kommen in Massen.
"Unter dem Kommunismus gab es keinen Hunger. Heute muss jeder einen Garten von mindestens einem halben Hektar haben. Im September fahren selbst Lehrer und Ärzte aufs Land, um zu ernten und für den Winter einzukochen", erzählt Filip. Seit acht Jahren arbeitet sie in der Ukraine. Sie hat nicht den Eindruck, dass sich viel gebessert hätte. "Das Stadtbild hat sich geändert. Viele Fassaden sind herausgeputzt. Aber am Land ist alles gleich geblieben. Die ökonomischen Strukturen haben die Armen noch ärmer, die Reichen noch reicher gemacht." In ihrer Sozialarbeit als NGO kämpft sie gegen starre staatliche Strukturen. Es gibt keine Gesetze, die für Institutionen wie die Caritas Rahmenbedingungen schaffen.
Entlang der holprigen Bundesstraße von Konotop nach Kiew zeigt sich die landschaftliche Schönheit der Ukraine in ihrer ganzen Fülle. Reif hängen die Zwetschken an den Bäumen, orangene Kürbisse lugen aus der schwarzen Erde der endlos weiten Felder, die Fahrbahn mit den unzähligen, tiefen Schlaglöchern ist gesäumt von Apfelbäumen. Ein von der Natur beschenktes, fruchtbares, riesiges Land. Erntemäßige Geschäftigkeit herrscht nicht. Traktoren sieht man keine, auf einigen Feldern lassen sich nahe am Horizont zwei Pünktchen ausmachen: ein altes Bauernpaar, das gebückt die Ernte aufklaubt.
Es fehlt an allem
Wohin das Auge blickt, es fehlt an allem. Maschinen, um das Land zu bestellen, sind Mangelware, die Industrie, die die Produkte weiterverarbeiten, exportieren und vermarkten könnte, liegt brach. Die ehemalige "Kornkammer der Sowjetunion" ist heute selbst bei Grundnahrungsmitteln von Importen abhängig. Abgesehen von den Profiteuren, die am korrupten, maroden Staat verdienen, lebt die Nation von Selbstversorgung. Wer etwas zu verkaufen hat, stellt sich mit Plastikkübeln voll Obst und Gemüse auf die Straße. Wer einen alten Lada oder Skoda hat, fährt frühmorgens in die Städte, um auf den Basaren seine Ware feilzubieten.
Nachts liegen die Dörfer im Dunkel, Strom und Gas gibt es sporadisch. Warmwasser ist Luxus, in den Hotels der gehobenen Preisklasse fließt es, dort ist vom katastrophalen Zustand der Volkswirtschaft kaum etwas zu spüren. Den Reichen fehlt es an nichts: für sie gibt es Markenware, bildschöne Frauen an luxuriös eingerichteten Hotelbars, Fernseher am Zimmer, Luxuslimousinen. Der Rest darbt. Privatgärten, die die kleinen Häuschen am Land säumen, ernähren die Menschen.
Nur frische Politur
Der Schein trügt: hinter bunt gefärbelten Fassaden kämpfen sich alte Bäuerinnen mit zerfurchten, vom Leben gezeichneten Gesichtern durch einen mühsamen Alltag. Marja Sergejvna ist eine von ihnen: durch das Dach ihres Hauses regnet es, liebevoll hat sie die Tür ihres Plumpsklos im Garten mit bunten Zeitungsausschnitten vollgekleistert, das Wasser zum Kochen muss sie jeden Tag von der Pumpe hertragen. 17 Dollar Pension kriegt sie im Monat, früher konnte sie sich noch einen Urlaub in Rumänien leisten. Heute gehört sie zu den alten Frauen, die vom mobilen Dienst der Caritas betreut werden.
"Mutter Ukraine" heißt die 24 Tonnen schwere Skulptur, die in Kiew zu Ehren des zehnten Jahrestages der Ukrainischen Unabhängigkeit errichtet wurde. Die Kunst der großen Geste beherrscht man noch: als Staatsoberhaupt Leonid Kutschma von Dnipropetrovs'k nach Cernihiv fuhr, war das Gras schon braun. Es wurde mit grüner Farbe gespritzt, die Zäune davor weiß gefärbelt. Ob Jelzin, Papst oder Putin: bei jedem neuen Staatsbesuch frische Politur.
Die Nacht legt sich über Kiew. Laut dröhnt die Musik aus den Jukeboxen des Gidro-Parks am Dnjepr. In einem billigen Club der einsamen Herzen tanzen Paare. Fünf- bis zehnjährige Kinder versammeln sich um raufende Halbstarke, sie bleiben, bis Zigaretten und Sekt für sie abfallen. Alte Frauen sitzen an der Metro-Station, verkaufen Hummer, gepökelten Fisch, Gebäck. Auf den Parkbänken warten Zehn- bis Zwölfjährige auf Freier, sie werden bald im Gebüsch verschwinden. Hart ist der Überlebenskampf im dunklen Schatten der "Mutter Ukraine".
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!