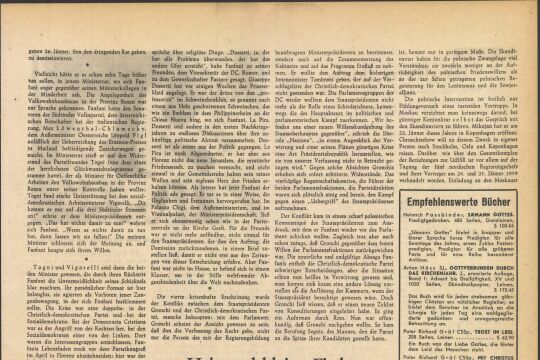An die Entscheidungen der EU gebunden - aber ohne Mitspracherecht: Im Vorfeld der historischen Erweiterung der Union überdenken die Norweger ihre Beitrittsskepsis.
Die norwegische Debatte um einen möglichen EU-Beitritt kommt wieder in Gang. Die Skandinavier hatte in zwei Volksabstimmungen 1972 und 1994 - als bisher einziges Land Europas - einen EU-Beitritt mehrheitlich abgelehnt und Europa zu einem öffentlichen Tabuthema gemacht.
Zum Erstaunen der norwegischen Öffentlichkeit war es im Januar 2003 ausgerechnet Ministerpräsident Kjell Magne Bondevik, der Europa wieder auf die politische Agenda beförderte. Der Chef der christlichen Volkspartei, die - wie das Zentrum, die Sozialistische Linkspartei und der liberale Venestre - bisher zu den dezidierten Europa-Gegnern gehörte, hatte erklärt, dass Norwegen wegen der weitreichenden politischen Konsequenzen der EU-Osterweiterung seine bisher ablehnende Position neu überdenken müsse. Außerdem sei, so Bondevik, ein starkes Europa als politisches Gegengewicht zu den USA begrüßenswert.
Trend pro EU
Bondevik scheint mit seinen Überlegungen den Nerv der Zeit getroffen zu haben. Durch die Veränderungen der politischen Landschaft Europas in den vergangenen Jahren scheinen die Norweger europafreundlicher geworden zu sein. Nach den jüngsten Umfragen schwankt die Zustimmung der Bevölkerung zu einem EU-Beitritt zwar zwischen 58 und 67 Prozent der Stimmen, der Trend "pro EU" bleibt jedoch stabil.
Im Grunde komme die Diskussion über einen EU-Beitritt gerade für die politischen Parteien etwas zu früh, meint Georg oevsthus, politischer Kommentator von Norwegens größter Regionalzeitung Bergens Tidende. Das Ja oder Nein zu einem EU-Beitritt habe beinahe den Status eines Glaubenssatzes, gelte seit den sechziger Jahren als das umstrittenste Thema der norwegischen Innenpolitik. Koalitionen seien an der Europa-Frage zerbrochen oder nie zustande gekommen, so oevsthus. Auch gegenwärtig könnte Europa die Mitte-Rechts-Minderheitsregierung aus Christdemokraten, der konservativen Hoeyre und den Liberalen, die von der rechtspopulistischen Fortschrittspartei geduldet wird, vor eine Zerreißprobe stellen.
Im Prinzip kann der Regierung Bondevik gar keine politische Lösung der Europafrage gelingen. In den Koalitionsvereinbarungen vom Oktober 2001 haben sich die drei Parteien nämlich auf eine so genannte "Selbstmordklausel" geeinigt. Danach würden formelle Verhandlungen über einen EU-Beitritt, den innerhalb der Regierung nur die Konservativen uneingeschränkt wollen, das Ende der Koalition bedeuten. Da die Verfassung keine vorgezogenen Neuwahlen kennt und die nächste Parlamentswahl erst 2005 ansteht, werden sich die Norweger noch mindestens zwei Jahre mit einer Entscheidung gedulden müssen.
Leichter tun sich deshalb die oppositionellen Sozialdemokraten. Europafreundliche Spitzenpolitiker wie die beiden ehemaligen Regierungschefs Thorbjoern Jagland und Jens Stoltenberg kämpfen für ein baldiges Referendum, in dem die Norweger endlich den Beitritt zur Europäischen Union absegnen sollen.
Schon allein der Begriff "Union" löse bei vielen seiner Mitbürgern eine mentale Blockade aus, meint oevsthus. Es erinnere sie an die aufgezwungene 400-jährige Union mit Dänemark und an die darauffolgende Abhängigkeit von Schweden. Eine dominante Brüsseler Zentrale rufe alte Ängste hervor. Außerdem befürchteten die Norweger, dass ein Beitritt die Balance der beiden politischen Grundpfeiler - ausgeprägtes internationales Engagement bei gleichzeitig betonter nationaler Souveränität - berühren könnte. Der norwegische Journalist hält die positiven Umfrageergebnisse deshalb für trügerisch und ist skeptisch, ob seine Landsleute bei einer dritten Volksabstimmung wirklich für Europa stimmen würden.
Waren es über viele Jahre gerade die großen Ölvorräte, die der isolationistischen Haltung die notwendige finanzielle Basis sicherten, so sind es nun gerade wirtschaftspolitische Aspekte, die für einen EU-Beitritt sprechen. Norwegen gehört wie Island und Liechtenstein seit 1994 dem Europäischen Währungsraum (EWR) an und partizipiert am europäischen Binnenmarkt. Dafür mussten Norwegen, Island und Lichtenstein bisher rund 24 Millionen Euro an die EU zahlen, von denen Norwegen 95 Prozent schultert.
Norwegen ist schon heute Nettozahler in Europa, an die Entscheidungen der EU gebunden, ohne jedoch das Mitspracherecht der EU-Mitgliedsstaaten zu besitzen. Zudem sieht die EWR-Mitgliedschaft nur einen zollfreien Handel von Industrieprodukten zwischen den EU-Ländern und Norwegen, nicht aber von Nahrungsmitteln und Fisch vor. Für Eivind Smith, Professor für öffentliches Recht an der Universität Oslo, ist der EWR-Vertrag wegen dieses Demokratie-Defizits eine "verfassungsrechtliche Katastrophe". Seiner Meinung könne dieses Problem nur dadurch gelöst werden, dass Norwegen entweder der EU beitrete oder aus dem EWR ausscheide und bilaterale Vereinbarungen mit Brüssel abschließe.
Zur Kasse gebeten
Parallel zu den Osterweiterungsverträgen sollte auf dem Athener EU-Gipfel der EWR-Vertrag geändert werden. Weil die EWR-Länder stark vom Binnenmarkt profitieren, verlangte die EU-Kommission eine massive Aufstockung der jährlichen Zahlungen - im Gespräch waren zwischen 200 und 500 Millionen Euro. Sie fließen in den EU-Kohäsionsfonds, von dem gegenwärtig Spanien, Portugal, Irland und Griechenland profitieren.
Nach langwierigen Verhandlungen einigten sich die Kommission und die EWR-Länder auf einen Kompromiss, nach dem die drei EWR-Staaten ab 2003 jährlich 120 Millionen Euro nach Brüssel abführen würden. Obwohl Norwegen von diesem Betrag den überwiegenden Teil übernehmen sollte, mussten die Skandinavier einer weiteren jährlichen Zahlung in Höhe von 113 Millionen Euro zustimmen, die direkt den zehn neuen EU-Mitgliedern zugute kommen sollte. Dieser Kompromiss scheiterte jedoch am Einspruch Polens, das gegen die Norwegen vertraglich ebenfalls auferlegten Fischquoten votierte. Danach hätten die osteuropäischen EU-Neulinge wie Polen oder die baltischen Staaten, die große fischverarbeitende Fabriken besitzen und bisher norwegischen Fisch zollfrei eingeführt haben, nach ihrem Beitritt nur noch bestimmte Mengen importieren dürfen. Polen befürchtete deshalb einen Verlust an Arbeitsplätzen in der Fischindustrie. Mit seinem Veto unterstützte Polen sogar eine Position Norwegens, die dessen Delegation nach Kontroversen mit der EU-Kommission schrittweise zurückgefahren hatte.
Neuer Partner Berlin
Trotz der auf Eis gelegten EWR-Verhandlungen will auch die stark exportorientierte norwegische Fischindustrie den EU-Beitritt, um ohne Handelsschranken Lachs und Dorsch in Europa vermarkten zu können. 1994 kämpfte sie aus Angst vor der Überfischung ihrer Heimatgründe durch die EU-Fischflotte noch entschieden gegen einen Beitritt.
Solange die EU-Diskussion weitergeht, braucht Norwegen als Mitglied des EWR und Nichtmitglied der EU starke Fürsprecher in Brüssel. Gerade deshalb kommt Deutschland eine zunehmend wichtigere Rolle in der norwegischen Außenpolitik zu.
1999 hat die norwegische Regierung eine politische Grundsatzentscheidung getroffen und eine eigene "Deutschland-Strategie" entworfen. Oslo rückt damit von der starken Anlehnung an Washington und London ab und will ein breitgefächertes Netzwerk an Norwegen-Fürsprechern in Deutschland aufbauen. Berlin soll wieder zur Drehscheibe für den kulturellen Austausch zwischen Skandinavien und Mitteleuropa werden. Dieser Strategiewechsel hat verschiedene Gründe: Die Bundesrepublik ist in den Augen der Norweger einer der Motoren der EU-Norderweiterung und wichtigster Fürsprecher norwegischer Interessen in der EU. Norwegen und Deutschland verbindet eine enge Kooperation in der NATO und die besondere außenpolitische Rücksichtnahme auf die Belange Russlands. Deutschland ist Norwegens wichtigster Handelspartner. Doch bevor der Weg nach Brüssel über Berlin führt, müssen die Norweger zunächst selbst entscheiden, ob sie in der EU wirklich ihre Zukunft sehen. Ein Ja könnte langlebige innenpolitische Verkrampfungen lösen, meint Georg oevsthus, denn nach einem Beitritt wären Kontroversen über die Europapolitik keine Grundsatzfragen, sondern genauso alltägliche Vorgänge wie politische Auseinandersetzungen über jedes andere Thema.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!