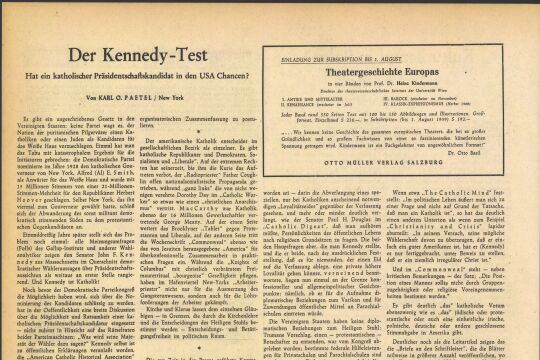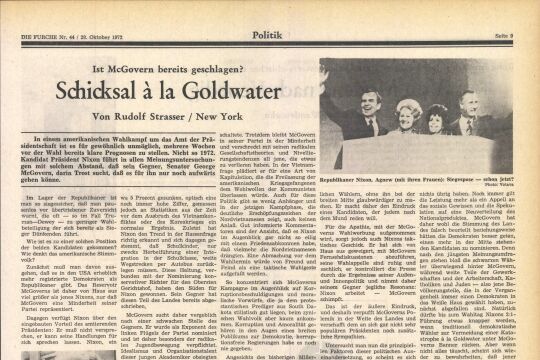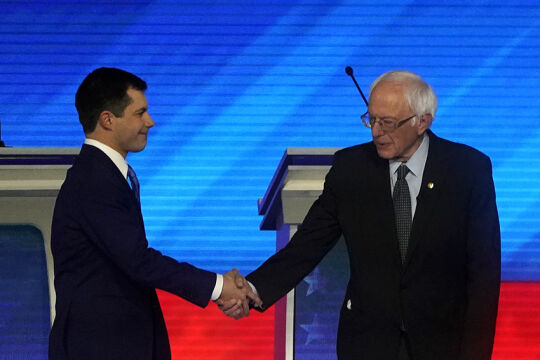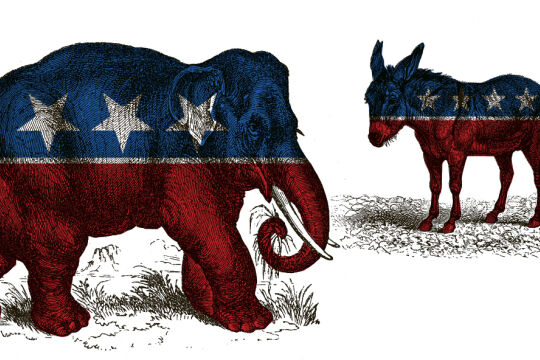Zwei Jahre nach seiner Wahl muss US-Präsident Barack Obama bei den Kongresswahlen eine Niederlage einstecken. Wie es vom Obama-Hype zur Midterm-Ernüchterung kam, analysiert Medienberater und Politikanalyst Peter Plaikner aus der Sicht von Politikberatern, die er in Washington traf.
Union Station, Washington, D. C., 3. November 2008: Es gibt keine Obamas mehr. In der Papeterie kostet Biden gleich viel wie McCain, aber auf Palin klebt: "For free". Angebot und Nachfrage steuern auch die Hitparade der Pappkameraden. Schon Allerheiligen, am Tag vor der Wahl, hatte Karlyn Bowman, führende republikanische Marktforscherin vom "American Enterprise Institute", erklärt, warum die demokratische Ära weit über 2016 anbrechen könnte: "Der Vorsprung sagt weniger über die Politik Obamas, sondern mehr über Bush und den Zustand der Republikaner."
Time Nr.19, November 2010: "Sie waren die zwei unumstrittenen Stars der Kampagne 2008: frisch, charismatisch, elektrisierend", hebt das Nachrichtenmagazin Sarah Palin im Nachhinein auf eine Stufe mit Barack Obama - und beide aktuell in den Schatten der Tea Party. Als prototypisches "Grassroots Movement" beschert sie der Partei der Bushs und Reagans eine raschere Wiedergeburt, als alle politischen Beobachter vor zwei Jahren geglaubt hatten. Doch die erzkonservative Bewegung aus dem Nichts ist sogar vielen Republikanern ungeheuer.
Armeen von Davids
Nancy Bocskor etwa. Sie ist Spezialistin fürs Fundraising, das Auftreiben von Spenden zur Politikfinanzierung, und hat bei Newt Gingrich begonnen, mit dem die Republikaner 1994 erstmals nach vier Jahrzehnten beide Häuser des Kongresses gewannen. Doch Sarah Palin empfindet sie heute als zu geräuschvoll für eine Kandidatur als Präsidentin 2012.
Das sieht Joe Trippi ähnlich: Der "Neuerfinder des Campaigning" hat nach seiner Arbeit für den Demokraten Howard Dean 2004 mit "The revolution will not be televised" das Standardwerk für Wahlkampf in der Online-Ära verfasst. Er sagt: "Das Establishment der Republikaner wird Palin nie akzeptieren", und verweist auf die New York Times, die jetzt schon weiß, wann die bekannteste Vertreterin der "Grand Old Party" intern vernichtet wird. Die Demontage beginnt am Tag nach jenen Midterm Elections, für die Joe Trippi Jerry Brown beraten hat, den demokratischen Nachfolger des Republikaners Arnold Schwarzenegger. Ausnahmen bestätigen die Regel. Trippi definiert die Regeln neu: "Das Internet kreiert Armeen von Davids. Da will ich nicht Goliath sein." Lieber versorgt der Berater seine Klienten mit den Steinen, um die Riesen zu stürzen. Jerry Browns Gegenkandidatin Meg Whitman hat 140 Millionen Privatvermögen in ihren vergeblichen Wahlkampf gesteckt.
Dabei ist der Digital-Pionier ein Analog-Routinier. Trippi hat schon 1980 für Ted Kennedy begonnen, aber die Veränderungen durch das Web wie kaum ein anderer Langzeit-Consulter verinnerlicht. Die Revolution wird nicht im Fernsehen gezeigt, sie vollzieht sich via YouTube, Facebook und Twitter.
Doch weil die wichtigen politikwissenschaftlichen Journale diese Entwicklung von Internet und Politik auch in den USA bis vor fünf Jahren verschlafen haben, sind Typen wie Alan Rosenblatt längst aus dem akademischen Betrieb verschwunden. Im "Center For American Progress" findet der Politikwissenschaftler mehr Entfaltungsmöglichkeiten. In "Social Networks" wie Facebook sieht er eine Möglichkeit, die Protestkultur aus den 1960er-Jahren auf eine breitere Plattform zu stellen. Wie Trippi schwört er darauf, dass heute nicht mehr der Wähler die Information suchen muss, denn die Information findet den Wähler. Rosenblatt mag den Inhalt gewählt haben, sein Geschäft funktioniert nur technikgestützt: Über jeden US-Bürger sind 200 Eigenheiten gespeichert. Der Datenhandel blüht.
McKenna, Long & Aldridge, Washington, D. C., 2. November 2010: Howard Dean empfängt am Wahlabend entspannt den Master-Lehrgang Politische Kommunikation von der Donau-Universität Krems. Der einstige Chef und Präsidentschaftskandidat der Demokraten ist heute selbstständiger "Consulter". Er hat gerade die britischen Liberaldemokraten beraten. "Die Tea Party glaubt nur, sie sei gegen Big Government. Doch auf einer Veranstaltung vor wahrscheinlich tausend Leuten habe ich gefragt, wer die staatliche Gesundheitsversorgung in Anspruch nimmt. Antwort: alle. Also habe ich nachgehakt, wer darauf verzichten will. Antwort: niemand." Da grinst der Demokrat - um dann ernst auf einen Kardinal- bzw. Personalfehler Obamas hinzuweisen: "Die Leute, die eine Kampagne leiten, eignen sich selten für die Regierungsarbeit." Der politisch-mediale Komplex in Washington 2008, das war ein einziger großer Konsens über die Faszination Obamas, aber fast ebensolche Einigkeit, man wisse noch nicht, wer er ist, wofür er steht. 2010 sind alle schlauer. "Der Wunsch nach Change war längst da. Obama hat ihn reflektiert wie ein Parabolspiegel", sagt Howard Dean. Da ist er sich einig mit Nancy Bocskor, Joe Trippi und Alan Rosenblatt. Obama hat vor allem gewonnen, weil er nicht Bush war. Nun gewinnt die Tea Party, weil sie nicht Obama ist.
Anti-Bush und Anti-Obmama
Doch weil nach der Wahl auch hier vor der Wahl ist, geht es schon um die Präsidentschaftskür 2012. Und da warnt Carroll Doherty vom "Pew Research Center", einem öffentlichen Meinungsforschungsinstitut, vor Unterschätzung: "Obama ist nicht nur populärer als die Demokraten im Kongress, er ist auch populärer als seine Politik." Die Republikaner dagegen haben zwar die Tea Party, aber trotz Senkrechtstartern wie Floridas Neo-Senator Marco Rubio noch keine klare Führungsfigur. Beides wird ihnen zu schaffen machen.
Die als Ex-Hexe zu zweifelhafter Popularität gelangte Christine O'Donnell ist in Delaware zwar ihrem demokratischen Widersacher unterlegen, doch ihre Rede zur Niederlage ist eine klare Kampfansage nicht nur an die gegnerische Partei: "Die Regierungsmacht wird nicht mehr die gleiche sein. Das ist eine gute Sache. Die republikanische Partei wird nicht mehr die gleiche sein. Das ist eine großartige Sache. Doch das ist erst der Anfang." Zu Allerseelen um 21 Uhr Ortszeit in Washington, D. C. war den Republikanern die Kontrolle über das Repräsentantenhaus sicher, doch um Mitternacht hatten die Demokraten wenigstens ihre Mehrheit im Senat verteidigt. Bill Clinton wurde 1996 klar wiedergewählt, obwohl seine Partei 1994 beide Kammern im Kongress verloren hatte.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!