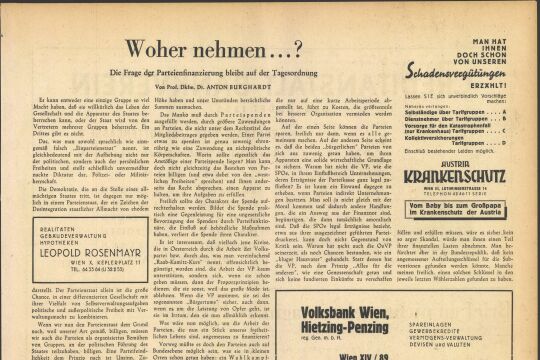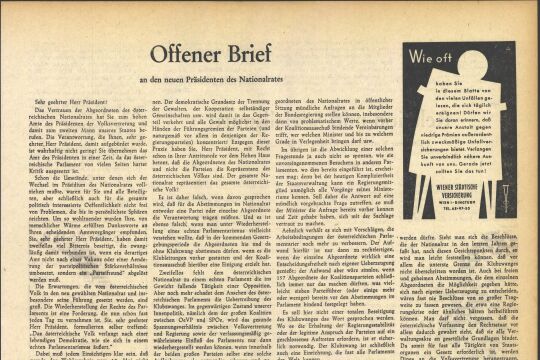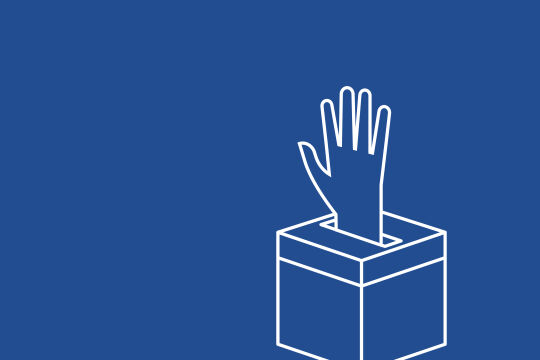Kann ein Mehrheitswahlrecht die Demokratie beleben? Die Grüne Vize-Chefin Eva Glawischnig diskutiert mit Heinrich Neisser, Obmann der "Initiative Mehrheitswahlrecht".
Die Furche: Frau Dritte Nationalratspräsidentin, sehen Sie überhaupt einen Änderungsbedarf beim Wahlrecht?
Eva Glawischnig: Sehr wohl! Wir brauchen einen Debatte darüber, auf welcher Ebene Menschen, die ohne Staatsbürgerschaft in Österreich leben, politisch mitgestalten können. Diese Gruppe auszuklammern, ist auf Dauer nicht tragbar, da bricht die Gesellschaft auseinander. Allerdings sehe ich eine große Unzufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger mit der politischen Praxis. Ein neues Wahlrecht kann dabei nicht die Lösung gegen diesen Unmut sein. Das Wahlrecht wäre das letzte, an das ich denken würde; es geht doch vor allem um eine Änderung der politischen Kultur insgesamt.
Die Furche: Herr Professor Neisser, warum also doch mit dem Wahlrecht anfangen?
Heinrich Neisser: Ich glaube, dass die Wahlrechtsfrage eine essenzielle Diskussion ist, mit der man versuchen kann, diese Demokratie wieder lebendig zu machen. Ich stimme dem zu, was Sie, Frau Glawischnig, als Anliegen genannt haben, aber ich würde weiter darüber hinausgehen: Eine Kernfrage ist doch das Verhältnis zwischen Wählern und Mandataren, das durch ein neues Wahlrecht verbessert werden kann: Abgeordnete sind weitgehend unbekannt; ich stelle fest, dass das Parlament zunehmend bedeutungslos wird. Eine Wahlrechtsreform ist kein Wundermittel. Aber wenn man versucht, eine Sensibilität für das Thema zu erzeugen, dann werden die Menschen darüber nachdenken. Wir, die Initiative, gehen nicht davon aus, dass man in den nächsten zwei Jahren ein Modell auf den Tisch legt und realisiert, das wird nicht geschehen, das ist mir völlig klar; aber wir erkennen in diesem Land viel zu wenig, welche Funktion ein Wahlrecht haben kann, und das soll in einer Diskussion mit den Bürgern deutlich gemacht werden.
Glawischnig: Vorrangig ist doch die Frage, warum der Parlamentarismus nicht funktioniert und wie mit Bürgeranliegen umgegangen wird. Das wissen Sie ja noch selbst aus Ihrer Zeit als Zweiter Nationalratspräsident: Petitionen verschimmeln im Petitionsausschuss. Volksbegehrer haben kein Rederecht. Regierungsvorlagen gehen teilweise auf Punkt und Strich unverändert durchs Hohe Haus. Das ist schon eine Frage des Selbstbewusstseins der Parlamentarier: arbeiten die wirklich oder sind sie nur der verlängerte Arm der Regierung? Durch eine Wahlrechtsreform ist das nicht zu ändern. Im Gegenteil: diese Mehrheitsdiskussion entfremdet die Bürger noch mehr von der Politik.
Die Furche: Inwiefern?
Glawischnig: Wenn man nicht das Glück hat, dass die Partei, die man gewählt hat, dann in der Regierung sitzt, war die Stimme praktisch wertlos. Das ist doch noch frustrierender. Hans Kelsen hat schon recht gehabt, wenn er von der Wichtigkeit des Interessensausgleichs gesprochen hat. Das setzt voraus, dass die Mehrheitsverhältnisse in der Bevölkerung auch im Parlament abgebildet sind. Ein großes Problem zur Zeit ist der Kulturverfall bei SPÖ und noch mehr ÖVP: zwei extrem verfeindete Lager. Durch ein Mehrheitswahlrecht würde das noch verstärkt.
Neisser: Sie haben gesagt, es sei eine Frage des Selbstverständnisses der Parlamentarier. Genau das ist der Punkt. Dieses mangelnde Selbstverständnis der Parlamentarier ist schon wesentlich durch das Wahlrecht bedingt. Unser Proportionalwahlrecht ist mit dem Listenwahlrecht untrennbar verbunden. Die Liste ist das Dokument der Macht der Partei. Auf der Liste sein, ist alles. Da bleibt Persönlichkeit auf der Strecke. Genau das ist der Ansatzpunkt. Aber die Diskussion über das Mehrheitswahlrecht leidet immer unter der Furcht, man wolle die kleinen Parteien auslöschen. Davon kann doch keine Rede sein.
Die Furche: Wie wollen Sie den kleinen Parteien die Furcht nehmen?
Neisser: Es gibt Modelle des Mehrheitswahlrechtes, wo man Minderheiten garantieren kann. Im Vordergrund steht aber die Frage nach einem Wahlrecht, das die persönliche Verantwortung des Mandatars gegenüber dem Bürger verstärkt, nicht nur am Wahltag, sondern über die ganze Legislaturperiode. Es bräuchte ein Wahlrecht, das stark personalisiert ist. Das System der Vorzugsstimmen bringt eigentlich fast nichts.
Die Furche: Würden Sie also das minderheitenfreundliche Mehrheitswahlrechtsmodell nach dem Grazer Politologen Klaus Poier befürworten?
Neisser: Da sind die Meinungen in unserer Initiative völlig unterschiedlich. Es gibt eine ziemlich starke Mehrheit gegen das englische Modell und eine gewisse Faszination für das französische System (siehe unten). In Frankreich gibt es die Möglichkeit einer Stichwahl: dies garantiert erstens eine absolute Mehrheit und zweitens hat das auch ein starkes Personalisierungs-Element. Aber natürlich kann man solche Wahlsysteme nicht 1:1 auf Österreich umlegen. Da müssen wir selbst Überlegungen anstellen.
Glawischnig: Die Furcht der kleinen Parteien ist schon berechtigt. Ich sehe das als extrem überheblich, wenn ein Wahlrecht bereits vorschreibt, wer jemals regieren kann und wer nicht. Überall dort, wo die Grünen bereits mitregieren, in Oberösterreich und jetzt auch in Graz, ist die Regierungsarbeit absolut in Ordnung. Keine Spur von Vernaderung, wie ich sie auf Bundesebene sehe. Per Gesetz ausgeschlossen zu sein, jemals auf Bundesebene zu regieren, das will ich nicht einsehen. Sie dürfen auch die Dynamik in einem Wahlkampf nicht vergessen. Welchen Sinn hätte es noch, kleine Parteien zu wählen?
Neisser: Aber der Sinn unserer Initiative ist es ja gerade, dieser Form der Koalitionsbildung entgegenzuwirken, wie sie in Österreich vor allem in letzter Zeit praktiziert wird. Ich glaube, ein Mehrheitswahlrecht würde für kleinere Parteien sogar die Chancen erhöhen, als Regierungspartner tätig zu werden.
Glawischnig: Sie meinen Rechenmodelle, wo die Mehrheitspartei knapp 50 Prozent der Mandate erhält und noch einen Koalitionspartner suchen muss?
Neisser: Ja. Ich gebe zu, die Modellfrage ist eine sehr heikle. Es muss einfach ein Modell sein, das der Entwicklung entgegenwirkt, dass es immer zwangsläufig mit einer großen Koalition endet. Man sollte über die Modelle analytisch und kritisch nachdenken. Aber direkt mit dem Bürger und nicht in Kommissionen, Komitees oder Konventen, wo all jene zusammensitzen, die ohnedies immer beieinandersitzen und dann versuchen, irgendetwas Neues zu finden, das ihnen aber selbst nicht wehtut.
Glawischnig: Wäre es nach Ihrer Argumentation dann nicht logischer, mehr direktdemokratische Instrumente einzurichten. Man denke an das Vetovolksbegehren, das es in Italien und der Schweiz als Korrektur zu Entscheidungen im Parlament gibt. Oder überhaupt an die Möglichkeit, bei bestimmten Volksbegehren zwingende Volksabstimmungen zu machen. Aber da sind wir doch auf einer anderen Ebene und nicht unbedingt beim Wahlrecht.
Neisser: Das kann man nicht als Entweder-Oder formulieren. Wir werden nie die Referendum-Kultur der Schweiz erreichen. Aber ich bin dafür, dass man unmittelbare Mitbestimmungsmöglichkeiten verstärkt. Wir haben ja Instrumente: Es hat bisher in der Zweiten Republik über 20 Volksbegehren gegeben, aber nur zwei Volksabstimmungen (Kernenergie Ja oder Nein und über den Beitritt zur EU). Von einer Volksbefragung, die seit 1988 bundesweit möglich ist, hat man bisher noch nie Gebrauch gemacht.
Glawischnig: Da sind wir wieder bei der Frage der politischen Kultur. Da ließe sich an Dutzenden Schrauben drehen: etwa eine Aufwertung des Petitionsausschusses im Parlament oder Untersuchungsausschüsse als Minderheitenrecht. Auch die Fragestunden müssten attraktiver gestaltet werden, das sind momentan Programme zur Politikverscheuchung, das hat nichts mit einer Auseinandersetzung zu tun. Es geht auch um eine Blutauffrischung. Die jüngeren Abgeordneten, die noch nicht 30 Jahre in der Politik sind und rein machtstrategisch denken, die arbeiten gut zusammen.
Neisser: Ich gebe schon zu, dass es theoretisch möglich wäre, auch in einem strikten System des Verhältniswahlrechtes etwas zu bewegen, wenn man starke Persönlichkeiten hat. Aber die Wirklichkeit schaut anders aus. Es stellt sich die Frage, soll man mit den institutionellen Reformen anfangen oder folgen die dann dem geänderten Bewusstsein aufgrund einer Wahlrechtsreform? Es wäre an der Zeit, das zu diskutieren.
Glawischnig: Wobei manche Äußerungen von Vertretern Ihrer Initiative für mich grenzwertig waren. Etwa die Aussage, die Parteien im Parlament seien großteils unnütz (von Gerd Bacher, Anm.). Das klingt nach einer grundsätzlichen Demokratiefeindlichkeit nach dem Motto "Quatschbude Parlament." Das ist kein guter Start für eine Diskussion.
Neisser: Sie haben recht, mit Worten muss man vorsichtig sein, auch mit dem Wort "Quatschbude", das an eine faschistoide Zeit erinnert. Ich sehe keine Ablehnung des Parlamentarismus, aber die Parteien sind großteils versteinert. Und man muss sie in Bewegung bringen. Die Parteien werden der essenziellen Aufgabe, neue Personen als Repräsentanten der Gesellschaft in die politische Arena zu bringen, nicht gerecht. Die Grünen haben eine gewisse Flexibilität, aber die Grünen sind nicht die Republik. Wir haben andere Parteien, die Machtträger sind und im Gebrauch der Macht wenig zurückhaltend.
Glawischnig: Man müsste auch über das Parteiengesetz reden, wie könnte man eine Öffnung vorschreiben. Zur Zeit gibt es keine Vorgaben von demokratischen Prozessen. Im Grunde kann man Listen erstellen, wie man will, das kann der Parteivorsitzende alleine bestimmen. Man könnte Grundsätze formulieren.
Neisser: Auch das ist nicht geschehen. Ich erinnere mich, wir hatten vor mehr als 20 Jahren eine schüchterne Diskussion darüber, ob es innerparteiliche Vorwahlen geben soll. Da ist total von den Parteien abgelehnt worden. Man hatte eine riesige Angst davor, weil Vorwahlen dazu führen würden, dass es doch zu einer Art Wettbewerb kommt. Natürlich ist das immer eine Chance für Populisten, die ich nicht gerne in der Politik sehe. Das muss man in Kauf nehmen. Wir machen Demokratie immer aus einer Ängstlichkeit heraus.
Die Furche: Was halten Sie eigentlich von Mischformen: ein Wahldurchgang nach dem Mehrheitswahlrecht, einer nach dem Verhältniswahlrecht?
Neisser: Solche Modelle wären ein guter erster Schritt in Richtung Mehrheitswahlrecht, um es zu erproben. Man sollte das deutsche Modell anstreben. Man muss es nicht 1:1 übernehmen, aber die Grundidee ist richtig: Die so genannten "Einer-Wahlkreise" sind für die Konkurrenz von Kandidaten wichtig, es gibt aber auch eine Bundesliste, die das demokratische Verteilungs- und Gerechtigkeitsprinzip aufrechterhält (siehe Seite 2).
Glawischnig: Nach meiner politischen Erfahrung werden die großen Parteien das Wahlrecht so gestalten, dass beide davon profitieren.
Neisser: Die großen wie die kleinen Parteien haben ein gemeinsames Problem: Sobald wir ein Modell für eine Wahlrechtsreform vorlegen, wird sofort ausgerechnet, wie sich das auf den Status-Quo auswirkt. Dieses Denken wird sich bald überholen. Die Wähler wechseln, das Lagerdenken ist vorbei.
Die Furche: Sie sagen selbst, wie reformunfreudig die Österreicher sind. Ist das Vorhaben der Initiative realistisch?
Neisser: Das Mehrheitswahlrecht in einer reinen Form halte ich für unrealistisch. Aber ich sage es noch einmal: Mir geht es darum, eine Stiländerung auch in Reformdebatten herbeizuführen. In Österreich haben wir noch immer eine etatistische Tradition: Man wartet, was der Staat sagt und tut. Das ist das Gegenteil einer modernen liberalen Demokratie, die verlangt, dass sich Reformen von unten her aus einer Diskussion entwickeln. Das ist das Schwierigste an unserem Projekt: diese Diskussion in die Gesellschaft hineinzutragen. Warum gibt es in diesem Land nicht einmal ein Volksbegehren über die Reform der Demokratie?
Glawischnig: Wir unterstützen jegliche Initiative für mehr Demokratie, aber es dürfen die Ergebnisse nicht vorher feststehen, wie etwa das Mehrheitswahlrecht.
Das Gespräch moderierte Regine Bogensberger.