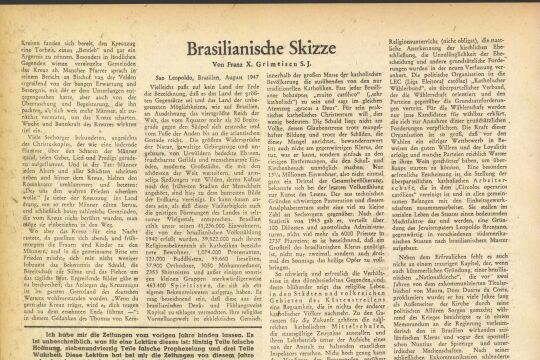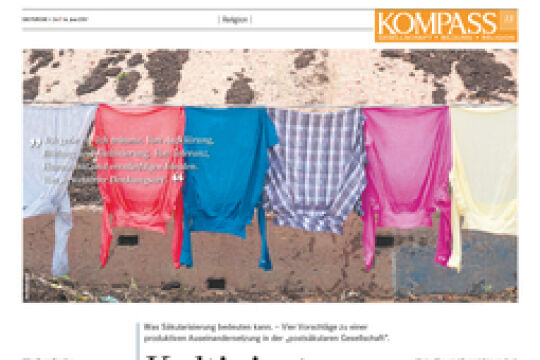Mit seinen ungewöhnlichen Thesen bringt der Philosoph Charles Taylor neuen Schwung in die alte Diskussion über das Verhältnis von Staat und Religion.
Lange galt es als ausgemacht: Religion und Moderne vertragen sich nicht – im Gegenteil. Religion bremse die gesellschaftliche Modernisierung, als Amalgam von Tradition, Institution und Mythos hemme sie die volle Entfaltung der Vernunft, ihre Marginalisierung bedeute daher einen Freiheitsgewinn, eröffne Horizonte und entlasse den Menschen damit aus seiner selbstgewählten Unmündigkeit. Säkularisierung als komplexer Prozess nicht nur der Trennung von Kirche und Staat, sondern auch der „Entmythologisierung“ der Welt und schließlich der Privatisierung alles Religiösen war geboren. Religion, so die Überzeugung, wird sich damit früher oder später im Geschichtssand als Irrweg verlieren.
Man muss kein Soziologe sein, um angesichts der Fortexistenz des Religiösen in seiner ganzen Vielfalt die Eindimensionalität dieser These zu erkennen. Auch die zahlreichen Pathologien der Moderne – von Sinnkrisen und seelischen Entleerungen bis hin zu ausufernder, nihilistischer Gewalt – zeugen davon, dass nicht jeder den entvölkerten Himmel und die bodenlose Säkularität aushält. Entsprechend demonstrieren blühende Säkularisierungsdebatten, dass das Thema wieder am Tapet ist, mehr noch: dass man an einer wichtigen Wegscheide steht. Gesteht sich nämlich die Soziologie mit gesenktem Kopf ein, dass es selbst im vermeintlich säkularen Westen Momente der Ungleichzeitigkeit, ja der triefend-erfahrungssatten Religiosität wie etwa in den USA gibt, so wittern Religionsapologeten Morgenluft. Wir haben’s doch immer schon gewusst – ihr kommt ohne uns nicht aus!
In dieser Situation gilt es nun jedoch inne zu halten: Entsäkularisierung, gar Re-Sakralisierung kann gewiss nicht der Weg sein. Zu sehr ist die säkulare Lebensform zur Selbstverständlichkeit geworden, als dass ein geschlossenes religiöses Weltbild eine ungebrochen christliche Existenz darin ohne Erschütterungen zu integrieren wäre. Aber auch eine forcierte Säkularisierung, die die letzten Residuen des Religiösen auszutrocknen trachtet und eine klinisch bereinigte Diskurskultur zum obersten Prinzip auch der Moral erklärt, kann nicht die Antwort sein.
Säkularität: nur eine Option von mehreren?
Das Ziel – so hat es sich etwa das Wiener „Institut für die Wissenschaft vom Menschen“ (IWM) in seiner jüngsten Transit-Publikation auf die Fahnen geschrieben – muss lauten, die Säkularisierung „neu zu denken“. Zum Vordenker avanciert dabei – neben Jürgen Habermas – der kanadische Philosoph Charles Taylor. Seine Stimme hat Gewicht – auch und gerade in theologischen Kreisen, ist er doch bekennender Katholik, der – wie kürzlich bei einer Begegnung mit Kardinal Christoph Schönborn im IWM – als Philosoph auch das Gespräch mit der Kirche nicht scheut.
In seinem Opus magnum „Ein säkulares Zeitalter“ erzählt Taylor eben jene Geschichte der Ungleichzeitigkeit, in der Säkularität als eine zentrale historische Option der vergangenen rund fünfhundert Jahre erscheint. Aber eben „nur“ eine Option: Es hätte alles auch ganz anders sein können. Die Geschichte der Moderne als eine Geschichte des Niedergangs von Religion, als eine „Subtraktionsgeschichte“ zu erzählen, hält Taylor für einen Analysefehler. Es geht ihm darum, Türen zu öffnen, Optionen aufzuzeigen, dass man religiös und säkular zugleich sein kann.
Die „Selbstverständlichkeit der abgeschlossenen Perspektive“, so Taylor, soll aufgebrochen werden. War es – so Taylors Gedankenexperiment – vor 500 Jahren „beinahe ein Ding der Unmöglichkeit, nicht an Gott zu glauben“, so hat sich dies heute komplett umgekehrt. Man müsse stets auch die umgekehrte Rechnung aufmachen und fragen, welche Verluste denn die radikale Modernisierung, die mit Entmythologisierung und Entzauberung, aber eben auch mit Traditionsabbrüchen und Nivellierungen einherging, mit sich bringe.
Was also meint dieses große Wort Säkularisierung? Taylor hat bei seiner sozio-philosophischen Reise durch die Zeiten insbesondere die radikalen Unterschiede zwischen dem kämpferischen französischen Laizismus und dem amerikanischen Säkularitätsverständnis vor Augen, stehen sich doch mit dem radikal-aufklärerischen Antiklerikalismus französischer Prägung, der seine historische Spitze in der Enthauptung des Königs als Inkarnation Gottes findet und den amerikanischen „Pilgrim-Fathers“ zwei Gründungsmythen gegenüber, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Seine Sympathien sind dabei klar verteilt, ist es doch das amerikanische Modell, das den verstockt-religionskritischen Europäern den Konnex von Religion und Moderne schmackhaft machen könnte.
Taylors Coup lautet dabei auf den Punkt gebracht: Säkularisierung bedeutet gerade nicht – wie bislang allgemein üblich –die Verhältnisbestimmung zwischen Staat und Religion, sondern sie betrifft die „adäquate Antwort des demokratischen Staates auf Andersheit“. Eine subtile, aber entscheidende Weichenstellung, verlagert sich der Fokus doch somit weg von der unter stetem Legitimierungsdruck stehenden Religion hin zum Rechtsstaat und zu seiner Einstellung der kulturellen und religiösen Pluralität gegenüber.
Anders gesagt: Ein Staat ist dann wirklich säkular im modernen Sinne, wenn er Religion nicht in Privatheit verbannt, sondern ihr Räume – auch Schutzräume – bietet, in denen sie ihr Potenzial entfalten kann. Es sind gerade Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, jener Dreiklang der französischen Revolution, die ihm dabei als Modell dienen: So sollte der Staat die religiöse Freiheit garantieren können, keine Religion bevorzugen, also Gleichheit walten lassen und schließlich die Gläubigen anhalten, in Brüderlichkeit miteinander zu leben. Eine Idylle angesichts Kopftuch-, Kreuz- und sonstiger eskalierender religiöser Konflikte? – Vielleicht, aber für Taylor der einzig gangbare Weg.
Mahner der Flexibilität
Was ist das genuin Neue, das Taylor damit zu bieten hat, wird man aus kontinentaleuropäischer Perspektive fragen. Kooperationsmodelle zwischen Staat und Religionsgemeinschaften mit einer fraglosen Favorisierung der christlichen Kirchen sind zumindest im deutschsprachigen Raum üblich. Auch ließe sich an Taylors Religionsbegriff aus theologischer Sicht Kritik anmelden – so etwa an seiner Verkürzung von Religion auf ihre Funktion als Kontingenzbewältigungspraxis in einer destabilisierten fragilen Moderne. Dennoch – man kann von Taylor, dem großen, im besten Sinne des Wortes liberalen Brückenbauer zwischen den Disziplinen, lernen.
So findet man sich nach der Taylor-Lektüre als von diffusen Ängsten getriebener, in verbissenen Religionsdiskursen verfangener Europäer vor den Scherben der eigenen aufgeklärten Liberalität wieder. Flexibilität fehle den europäischen Gesellschaften im Umgang mit Religion, mahnt Taylor zu Recht. Und an die Adresse der professionellen – kirchlichen – Religionsapologeten mag man hinzufügen: Lest Taylor und lernt, die Säkularisierung um der Religion willen zu verteidigen!
Oder, um es mit einem Kirchenvater der Moderne zu sagen – mit dem evangelischen Theologen und Vordenker eines neuen säkularen Paradigmas, Dietrich Bonhoeffer: Versteht Säkularisierung als Prozess der Weltwerdung! Diese „mündige Welt“, d.h. die aus quasi-religiösen Grundierungen des Politischen, letztlich wohl auch des Moralischen entbundene Welt ist laut Bonhoeffer „Gott-loser und darum vielleicht gerade Gott-näher als die unmündige Welt“. Dem religiös musikalischen Menschen gebe Gott damit zu verstehen, dass er leben müsse als ein solcher, der „mit dem Leben ohne Gott fertig wird“.
Wie lässt sich Säkularisierung heute aus religiöser Sicht besser beschreiben?
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!