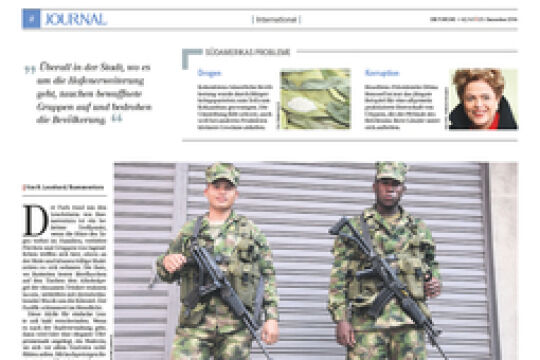Unerträgliche Lebens-und Arbeitsbedingungen erwarten
Einwanderer im Süden Spaniens.
Willkommen im weltweit größten industriellen Wintergarten: Im Süden Spaniens, zwischen den Städten El Ejido und der Provinzhauptstadt Almeria, versteckt sich die Erde. Die Sonnenstrahlen knallen auf ein weißes Plastikmeer. Die Landschaft ist verschwunden. Plastikhallen wohin das Auge reicht. Derzeit ist wieder Gemüsehochsaison in Andalusien. Täglich verlassen Tausende Lastwägen die Region, vollbeladen mit Gurken, Auberginen, Paprika, Tomaten... Geerntet wird das Gemüse von ausländischen Erntearbeitern: 96 Prozent der in der Landwirtschaft Beschäftigten in Almeria sind Immigranten.
Ohne die Einwanderer gibt es keine Ernte - das hindert Enciso Ruiz, den Bürgermeister von El Ejido, nicht, die soziale Gettoisierung der Immigranten voranzutreiben. Und er bekommt dafür Beifall von der ansässigen Bevölkerung und wird mit der absoluten Mehrheit belohnt.
"Der Bürgermeister schürt mit seiner Politik Rassismus", klagt die Menschenrechtsaktivistin Mercedes Garcia Fornieles. "Europa muss wissen, was hier passiert. Es sind einmal Abgeordnete des Europäischen Parlaments hergekommen. Sie haben sich ein Bild von der Lage gemacht und einen Bericht darüber verfasst. Was ist mit diesem Bericht passiert? Der muss im Mülleimer gelandet sein, denn wir haben nie mehr davon gehört. Das sind Komplizen für mich, denn in ganz Europa isst man Gemüse und Obst, das von Menschen gepflückt wird, die völlig entrechtet arbeiten, gedemütigte Menschen, auf denen man herumtrampelt. Was wir hier haben, ist neue Sklaverei."
Wer aufmuckt, fliegt raus
Wer sich in der Provinz von Almeria für die Immigranten einsetzt, hat mächtige Gegner: den Bürgermeister, die Unternehmerschaft, den Großteil der politischen Elite und rassistische Banden. Fornieles und ihre Mitstreiterinnen in der Organisation "Mujeres Progresistas" (Fortschrittliche Frauen) haben teuer für ihren Einsatz bezahlt: Ihr Büro in El Ejido wurde mehrmals verwüstet, Mercedes selbst verlor ihre Stelle in der Gemeindeverwaltung. Die täglichen Drohungen, bis hin zu Sabotageakten an ihren Autos, haben die Frauen zermürbt. Heute wohnt kein Mitglied der aktiven Kerngruppe mehr in der Stadt.
"Ich fühlte mich hier wie eine Aussätzige", erinnert sich die Aktivistin. "Auf der Straße beschimpften mich die Leute. Freundinnen, die ich seit meiner Kindheit kannte, verschmähten mich. Überall sah ich diesen Hass mir gegenüber. Die Leute wussten von meiner Arbeit aus dem Lokalfernsehen, das vom Bürgermeister kontrolliert wird. Da wurde gesagt, dass all das Schlechte in der Stadt von dem Immigranten und "Mujeres Progresistas" käme. Heute habe ich den Eindruck, dass die Menschen langsam anfangen zu verstehen, dass mein einziges Vergehen mein Glaube an die Verteidigung der Menschenrechte war." Auch wenn der Lebensmittelpunkt der 52-Jährigen seit 2003 nicht mehr El Ejido ist, gibt sie ihr soziales Engagement in der Region nicht auf.
Arbeiten bei über 50 Grad
Diese Haltung verbindet sie mit dem Marokkaner Abdelkader Shasha. Seit fünf Jahren arbeitet der ehemalige Tagelöhner für die Landarbeitergewerkschaft SOC, die einzige Gewerkschaft, die tatsächlich an Ort und Stelle anwesend ist. Rechtsvertretung für ein entrechtetes Heer von Billignomaden, das wie eine betriebsbereite Landmaschine bereitstehen soll. Legendär ist ein Fernsehauftritt von Bürgermeister Ruiz, bei dem er verkündete: "In der Früh brauchen wir die Arbeiter. Am Abend sind sie überflüssig."
Nur zehn Prozent der Zugewanderten leben in menschenwürdigen Unterkünfte. Die Mehrheit haust in mit Plastikplanen verhüllten Baracken. "Die Leute arbeiten unter Plastik, schlafen im Plastik, sie kommen nie aus dem Plastik heraus", erregt sich Abdelkader Shasha. "Wer kann das schon überstehen. Das macht jeden kaputt. Ich kenne einige, die geisteskrank geworden sind, nachdem sie hier ein paar Jahre gearbeitet hatten - bei Temperaturen über 50 Grad, denn unter dem Plastik ist es immer doppelt so heiß wie draußen."
Das sind auch die Arbeitsbedingungen für den marokkanischen Landarbeiter Brachim. Seit fünf Jahren arbeitet er in den Treibhäusern. "Wenn du deinem Arbeitgeber sagst, du willst einen Vertrag, sagt der dir: ,Nein! Ich will einen Illegalen. Der arbeitet viel mehr und ist billiger.' Deswegen möchte ich nicht bleiben." Der Mindestlohn für einen Tag Arbeit beträgt 37 Euro und 20 Cent. Die meisten, die man fragt, bekommen zwischen 20 und 30 Euro, manchmal noch weniger.
Brachim ist Jurist. Er spricht drei Sprachen: Arabisch, Französisch und Spanisch. Mit seinem jüngeren Bruder teilt er sich eine Baracke. Kein fließendes Wasser. Kein Strom. Kein WC. Das Bett ist aus Plastiksteigen. "Wenn ich nach Hause telefoniere, dann erzähle ich immer, dass es nichts zu holen gibt in Spanien. Doch sie antworten mir immer: ,Du lügst!' Ich habe mittlerweile alles vergessen, was ich hatte und was ich wusste - meine Kultur, meine Traditionen. Und ich möchte auch alles vergessen. Das Leben ist nichts wert. Ich spreche mit niemandem mehr. Das Beste ist: arbeiten, schlafen, auf den Tod warten und aus."
Die Autorin ist ORF-Hörfunkredakteurin.