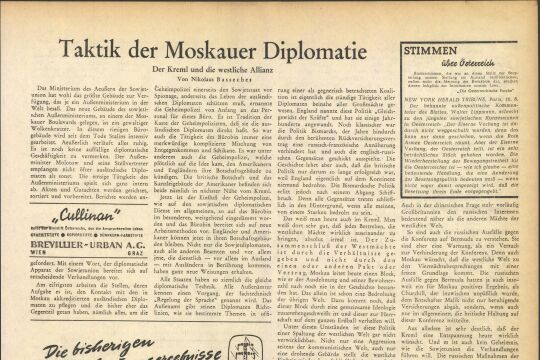Veraltete Geräte, karge Löhne - und ein bisschen Wehmut: Ein Lokalaugenschein an der Moskauer Lomonossow-Universität.
Beim schnellen Hinsehen ist es ein Bergkristall wie tausend andere, gelblich-schimmernd und mit einer Spange an einer Holzplatte festgemacht. Im hintersten Winkel des Geologischen Museums hat er seinen Ruheplatz gefunden. Doch kaum dringt ein Sonnenstrahl durch die Wolken-Stores, verwandeln sich die Mineraleinschlüsse des Steins in Bäume und Hügel. Eine Landschaft wird sichtbar - ähnlich jener im Ural, wo man das steinerne Phänomen einst geborgen hat.
"Der Bergkristall ist ein Wunder", schwärmt der Museumsführer und lotst uns weiter, vorbei an staubigen Vitrinen und verblassten Gemälden im Stil des sozialistischen Realismus. Hier oben, im 24. Stock der Moskauer Lomonossow-Universität, hat man die Wunder von Mutter Natur schätzen gelernt. Umso mehr, als die wundersamen Zuwendungen von Mütterchen Russland seit Jahren ausgeblieben sind.
Exodus kluger Köpfe
Um wieviel genau die staatlichen Zuschüsse nach dem Kollaps der Sowjetunion gesunken sind, kann Rektor Wiktor Sadownitschy nicht beziffern. Nur so viel verrät er den 25 Journalisten aus ganz Europa, die auf seine Einladung hin - und anlässlich der bevorstehenden 250-Jahr-Feiern - nach Moskau gekommen sind: "Russlands Wissenschaft hat drei Probleme: Wir haben nicht genug Geld, die jungen Forscher gehen ins Ausland, und die Laborausrüstungen sind nicht auf dem neuesten Stand der Technik." Sprach's - und ist auch schon verschwunden. "Ein wichtiger Termin mit Bürgermeister Jurij Luschkow", entschuldigt ihn die Übersetzerin.
Auch der für Forschung zuständige Vize-Rektor der Universität, Wladimir Belokurow, zeigt sich zugeknöpft, wenn es um Zahlen geht. "Ein Vergleich zur Sowjet-Zeit ist schwierig", meint er mit leiser Wehmut in der Stimme. "Damals haben wir das Geld nur vom Staat erhalten. Heute kooperieren wir auch mit der Industrie."
Eine ungeliebte, aber notwendige Flucht nach vorn. Ob sie allein reicht, um den Exodus junger, kluger Köpfe in die russische Privatwirtschaft oder an ausländische Universitäten zu stoppen, bleibt abzuwarten. Tatsache ist, dass sich ein Moskauer Universitätsprofessor - inklusive Zuschlägen - mit einem monatlichen Salär von 200 Euro zufrieden geben muss. "In russischen Firmen können diese Wissenschafter zehn Mal mehr verdienen", klagt der Vize-Rektor. Ein guter Grund, der Alma mater den Rücken zu kehren - zumal in Moskau, nach Tokio zweitteuerste Stadt der Welt.
Bis Russlands Jugendlichen eine - mehr oder weniger gut bezahlte - Forscherkarriere offensteht, müssen sie jede Menge Hürden überwinden. Eine der schwierigsten erwartet sie gleich zu Beginn: die Aufnahmeprüfung an die Universität. Nur einer von sechs Bewerbern schafft das strenge Ausleseverfahren. Gerade einmal 5.000 neue Gesichter mischen sich Jahr für Jahr unter die 40.000 Studierenden auf den Lenin-Hügeln.
Eine, die gerade um die Lizenz zum Lernen bangt, ist Alina. Die achtzehnjährige Tochter eines Arztes und einer Physikerin hat sich in das staubige, aber ruhige Geologie-Museum im 24. Stock zurückgezogen, um sich für die Aufnahmeprüfung in Japanisch vorzubereiten. Als Alternative hat sie sich auch an der japanischen Botschaft einem Test unterzogen, um gleich in Tokio studieren zu können. Bis das Ergebnis bekannt gegeben wird, heißt es aber sicherheitshalber lernen - und zittern.
Nicht alle sind zum Fürchten verdammt. Manche von Alinas Kollegen haben schon vor den Prüfungen die Antworten in der Tasche, glaubt die junge Frau zu wissen. "Es gibt Eltern, die zahlen 10.000 Dollar für einen Studienplatz und bekommen dann die Lösungen. Das ist Betrug", empört sie sich. "Jeder weiß das." Tatsächlich werden zehn bis 15 Prozent der Studienplätze verkauft, bestätigt Vizerektor Belokurow. Ob diese Käuflichkeit beim Studienplatz endet oder bis zum Doktortitel reicht, ist aber nicht zu erfahren.
Grundübel Korruption
Nicht nur die Studierenden, auch die Forscher leiden unter der chronischen Intransparenz: "Das Grundübel ist noch immer die Korruption", redet sich ein Professor in der Uni-Kantine den Frust von der Seele. Zudem werden die Wissenschafter auf Schritt und Tritt daran erinnert, ihre großen Träume möglichst klein zu halten. Schimmelflecken an den Wänden oder eine ausgefallene Heizung sind für viele noch erträglich. Doch wenn es darum geht, notwendige Geräte ins Reich der Illusionen zu verbannen, kehren viele der Hochschule den Rücken.
"In manchen Labors sind 90 Prozent der Mitarbeiter weggegangen", erzählt der Zellbiologe Dimitrij Sorow in fließendem Englisch, während er uns durch die Gänge des mächtigen Stalin-Baus in den Keller führt. Hier, in einem Labor des Belozersky Instituts für Physikalisch-Chemische Biologie, hat sich Sorow ein Refugium geschaffen, in dem es sich wissenschaftlich leben lässt. Voll Stolz zeigt er uns das einzige Gerät in dem kargen Raum: ein Laser-Mikroskop. Kostenpunkt: 250.000 Euro. Damit will er versuchen, den Einfluss der Mitochondrien - also der Energielieferanten der Zellen - auf den programmierten Zelltod im Herzgewebe noch besser nachzuspüren.
Für Möglichkeiten wie dieser - und den Vorteil, mit seiner Familie in Moskau bleiben zu können - nimmt Sorow ein Gehalt von 150 Euro monatlich in Kauf. "Ohne regelmäßig ins Ausland zu gehen, würde ich das nicht überleben", gesteht er. Für ihn persönlich, aber auch für die russische Wissenschaft insgesamt seien internationale Kooperationen das Überlebenselixier.
Und so zwingt sich Dimitrij Sorow zu Optimismus. Immerhin habe Präsident Putin im Unterschied zu seinem Vorgänger Gorbatschow, den er "hasse", die Notwendigkeit von Forschungsförderung realisiert: "Russland war immer berühmt für seine Grundlagenforschung, sogar unter Stalin", erklärt er uns, während wir vom Labor im Keller zurück in die pompöse Eingangshalle schlendern: "Sogar mit seinem kleinen Hirn hat Stalin verstanden, dass Forschung wichtig ist."
Forscherfreund Stalin
In der idyllischen Stadt Dubna an der Wolga hätte der wissenschaftsfreundliche Massenmörder besondere Genugtuung gefunden. Hier, zweieinhalb Autostunden vom Lärm der Hauptstadt entfernt, befindet sich ein Aushängeschild russischen Forschergeists - das "Joint Institute for Nuclear Research" (JINR). 1956 als Gemeinschaftsinstitut der sozialistischen Länder gegründet, gilt es heute neben CERN in Genf als Hochburg der Teilchenphysik. "Die neunziger Jahre haben wir nur durch internationale Kooperationen überstanden", erzählt uns Vize-Direktor Alexej Sissakian. Mittlerweile arbeiten hier 6.000 Forscher aus 60 Ländern und versuchen, mit Hilfe von Teilchenbeschleunigern superschwere Elemente zu erzeugen. Erst kürzlich konnte man die Periodentafel um die Elemente 113 und 115 erweitern.
Insgeheim reichen die Träume der Forscher von Dubna noch viel weiter - genauer gesagt bis nach Oslo, wo am 10. Oktober der Gewinner des Friedensnobelpreises verkündet wird. Seit 1997 wurde das JINR - gemeinsam mit CERN - alljährlich für die "Zusammenführung der Nationen auf der Basis friedlicher Atomforschung" für den Preis nominiert. Bis dato ohne Erfolg. Doch wer weiß: Vielleicht geschehen heuer in Oslo, wie einst in den Tiefen des Ural, noch Zeichen und Wunder...
Lesen Sie nächste Woche anlässlich des Starts der neuen Expedition zur Internationalen Raumstation ISS über Kosmonautentraining in Moskau und die Kooperationen mit Österreich.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!