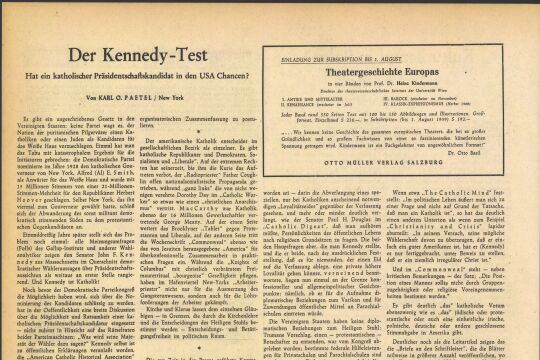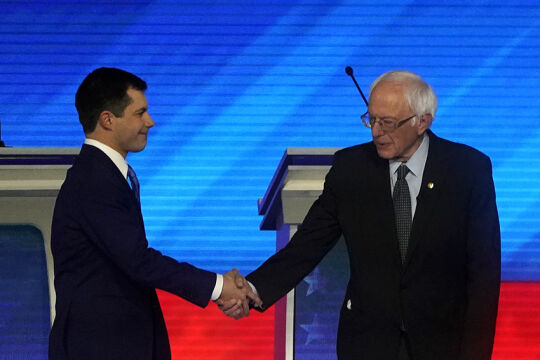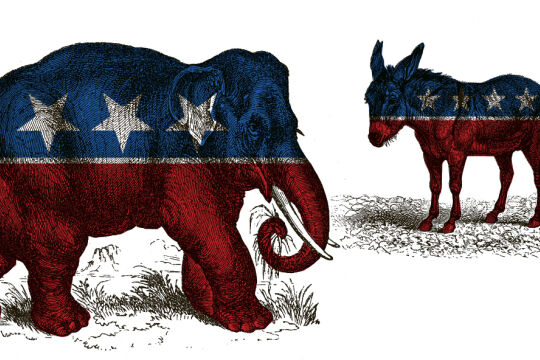Politischer Lokalaugenschein in den USA: Der Wahlkampf polarisiert das Land. Die Kampagnen setzen vor allem auf Negativität in der Darstellung des Gegners.
Wahlkämpfe sind eine simple Angelegenheit. Meist werden sie durch eine von zwei Emotionen entschieden: Angst oder Hoffnung. In den USA dominierten meist die Republikaner die erste Kategorie. In einem brutalen Wahlkampf rang 1988 George H.W. Bush den demokratischen Favoriten Michael Dukakis nieder. Sein Sohn George W. Bush machte es mit John Kerry 2004 ähnlich.
Die Demokraten setzten häufiger auf das Prinzip Hoffnung. Bill Clinton konnte praktischerweise gleich seinen Herkunftsort Hope, Arkansas, inszenieren und reüssierte auch bei der Wiederwahlkampagne 1996 mit seiner "Brücke ins 21. Jahrhundert“. Und dann war da noch Barack Obama. 2008 setzte er mit seinem Hoffnungswahlkampf und dem Slogan "Yes, we can“ neue Maßstäbe in der Generierung positiver Stimmung.
Obstruktionspolitik
Mit dieser Einstellung zog Obama ins Weiße Haus ein. Der 44. Präsident setzte nicht nur international auf gemeinsames Vorgehen, sondern wollte auch das Gros seiner innenpolitischen Vorhaben gemeinsam mit den Republikanern durchsetzen. Die Ernüchterung des naiven Newcomers folgte bald. Egal ob es ums Stimulus-Paket, die Rettung der US-Autoindustrie oder die Gesundheitsreform ging - die Republikaner verweigerten die Mitarbeit. Mitch McConnell, republikanischer Minderheitsführer im Senat, schwor seine Fraktion schon im Jänner 2009 auf reine Obstruktionspolitik ein. Das Kalkül: Obamas Glanz würde schnell verblassen, wenn er seine Versprechen nicht halten könne.
Die Erfolge fuhren die Republikaner bei den Zwischenwahlen 2010 ein. Sie produzierten enttäuschte demokratische Wähler und eroberten das Repräsentantenhaus im Sturm. Jetzt setzt Mitt Romney zum Sprung ins Weiße Haus an.
Trotz eines Charisma-Defizits beim Herausforderer und einiger Motivationsprobleme auch an der republikanischen Basis: Das Rennen kann knapp werden und es ist keineswegs gesichert, dass Obama am 6. November eine zweite Chance bekommt. Klar ist nur schon heute: In einer zweiten Amtszeit würde sich Obamas Stil ändern. Der Präsident wäre mit einer republikanischen Partei im "Bürgerkrieg“ (© Time) konfrontiert, die dann dem zu wenig konservativen Kandidaten Romney die Schuld für eine Niederlage in die Schuhe schieben würde. Auch aus diesem Grund, ließ der Präsident jüngst wissen, würde er wohl konfrontativer und härter gegen die Opposition agieren.
Das Ende des Prinzips Hoffnung
Im Wahlkampf tut er das schon jetzt. Seine bescheidene Bilanz als Präsident bedeutet auch das Ende des Prinzips Hoffnung in seiner Kampagne. Positiv-Botschaften sind rar. Seine Wahlstrategen sind sich einig: Ziel muss es sein, die unterschiedlichen Konzepte der Parteien klar zu kontrastieren. Der Weg zum Sieg führt für sie diesmal nur über die direkte Attacke auf Herausforderer Romney.
Von den hunderttausendfach gesendeten Obama-Einschaltungen waren bislang mehr als zwei Drittel negativ. Die Angriffe sind dabei meist auf die Schwächen des republikanischen Kandidaten gerichtet. In einem Vier-Minuten-Spot wird Romney als Flip-Flopper gebrandmarkt, der Positionen wie Unterhemden wechselt. Eine zweite Angriffswelle richtet sich gegen die eigentliche Stärke Romneys: Seine Bilanz als Sanierer in der Wirtschaft. Die Demokraten unterminieren sein Image als Jobgenerator. In einem Spot hört man "America the Beautiful“, ausbaufähig gesungen von Mitt Romney. Zur gesanglichen Darbietung sieht man Bilder von leergefegten Fabrikshallen und Bürogebäuden, dann Impressionen aus der Schweiz und von Traumstränden. Der Vorwurf: Erst hätte Romney die Jobs nach Indien, China und Mexiko outgesourct. Dann wäre das Geld für die Sanierungen bei den Eidgenossen und in der Karibik geparkt worden.
Schmutzige TV-Spots
Mitt Romney reagiert damit ebenfalls mit Attacke. Seine Spots sind sogar zu über 80 Prozent negativ. An der Bilanz Obamas wird dabei kein gutes Haar gelassen. Der Präsident sei überfordert, verstehe nichts von Wirtschaft und habe in praktisch jeder Situation falsche Entscheidungen getroffen. Seine angeblich sozialistische Prägung machen sie an unglücklichen Aussagen Obamas fest. Bei einem Auftritt hatte der auf die Notwendigkeit öffentlicher Investitionen hingewiesen. Als Unternehmer, so Obama, profitiere man davon. Man hätte die Infrastruktur ja nicht selber gebaut. Die von ihm verwendete Phrase "you didn’t build that“ verfolgt ihn seither in Spots, die beweisen sollen, dass Obama ein Gegner kleiner und mittelständischer Unternehmen ist.
Die Methoden der Verbreitung solcher negativer Botschaften sind 2012 raffinierter denn je. Der letzte Schrei ist mobiles Targeting. Dabei werden Wähler nicht nur eingeladen, etwa über Mobiltelefone unbürokratisch kleine Wahlspenden zu überweisen. Die Kampagnen sind auch imstande, Menschen sehr gezielt etwa bei regionalen Großveranstaltungen via Mobilgeräte mit Botschaften zu versorgen.
Die klassischen Wahlkampfhöhepunkte bleiben freilich auch diesmal die vier TV-Konfrontationen - drei davon bestreiten Obama und Romney, eine deren Vizepräsidentschaftsanwärter Joe Biden (D) und Paul Ryan (R).
Auch wenn die formalisierten Konfrontationen der Kandidaten wohl nicht so schmutzig werden wie die TV-Spots: Der Negativwahlkampf zeitigt auch in der medialen Berichterstattung Folgen. Laut Pew Research Center fallen bei beiden Kandidaten mehr als 70 Prozent der Berichte negativ aus. Obama werden in Befragungen Attribute wie "arrogant“, "inkompetent“ und "unsicher“ zugeschrieben. Romney besticht mit "elitär“, "verdorben“ oder "eigennützig“. Der Polit-Contest am 6. November bleibt also spannend. Gewinnen könnte am Ende der weniger unbeliebte Kandidat.
Thomas Hofer ist Politikberater in Wien und hat in den USA Wahlkampfmanagement studiert
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!