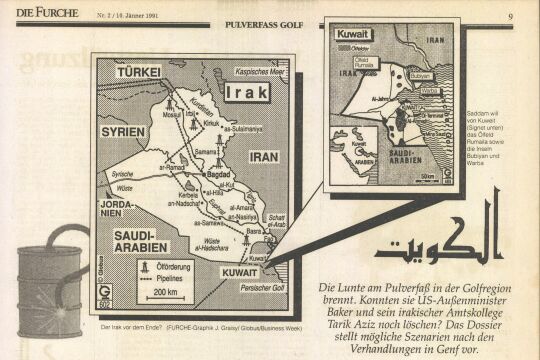Die Verzweiflung im Irak hat ein Maß erreicht, das plötzlich Ansätze zuzulassen scheint, die man sich vor vier Jahren, als sich die Irak-Invasion abzeichnete, gewünscht hätte: Wie wird die Region damit umgehen? Lässt sich das Projekt eines von den USA befreiten Irak ohne positive Einbindung der Nachbarländer überhaupt erfolgreich realisieren? Diese Fragen wurden damals nicht gestellt, aber jetzt, da der Irak immer mehr abrutscht, beginnen US-Politiker darüber zu räsonieren, ob man nicht mit dem Iran und mit Syrien darüber reden sollte.
Was logisch und vernünftig erscheint, ist in Wahrheit ein ungeheurer (im Wortsinn - nicht allen wird die Sache geheuer sein) Paradigmenwechsel in der amerikanischen Irak-Politik. Das irakische Regime wurde ja nicht trotz der Bedenken der Nachbarländer gestürzt, sondern sie - oder zumindest die nicht mit den USA verbündeten - waren Adressaten dieser dramatischen Veränderung in der Region: So war man in Teheran zwar hocherfreut über die Beseitigung des Erzfeindes Saddam Hussein, aber gleichzeitig war klar, dass auch der Iran auf der Liste derjenigen Länder stand, die nach Willen der - nunmehr im Nachbarland sitzenden - USA für einen "regime change" vorgesehen waren. Bei Syrien war die Sache noch offensichtlicher: Einer der strategischen Gründe, sich den Irak zu schnappen, oder zumindest ein höchstwillkommenes Nebenprodukt, war die geografische Umzingelung des letzten Baath-Regimes.
Das hat in Teheran und Damaskus nicht gerade die konstruktivsten Kräfte gefördert, um es euphemistisch auszudrücken. Deshalb jetzt der Versuch einer Korrektur - wobei es aber naiv wäre anzunehmen, der Krieg im Irak könnte nur von außen gestoppt werden.
Die Autorin ist Außenpolitik-Ressortleiterin des "Standard".
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!